Blinde Tunnel
Das Berliner U-Bahnnetz birgt eine ganze Reihe Tunnel, die der normale Fahrgast nie zu Gesicht bekommt. Hierbei müssen zwei Arten von Tunneln unterschieden werden: Die betriebsinternen Tunnel, die heute noch tagtäglich für den internen Gebrauch der BVG benötigt werden und zum anderen die Tunnel, die heute ohne Funktion sind oder niemals eine Funktion für die U-Bahn hatten und als "blinde Tunnel" klassifiziert werden.
Lesen Sie auch den Bericht zu den "betriebsinternen Tunneln"
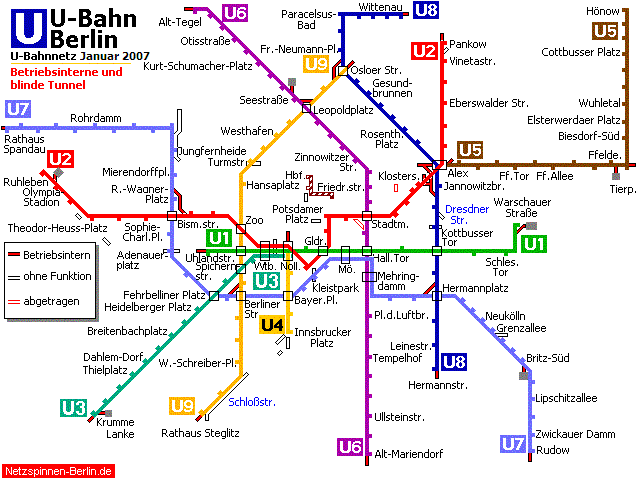
Die blinden Tunnel:
Blinde Tunnel gibt es in Berlin jede Menge. Es ist nicht auszuschließen, dass es unter der Stadt noch heute Tunnel gibt, die bislang noch nicht als solche entdeckt wurden, weil sie in Zusammenhang mit Tiefbauprojekten entstanden, die nichts mit der U-Bahn zu tun haben. Über die bekannten Tunnel soll nachfolgend berichtet werden.
Die
Phantomlinie:
Linie U10
Neu! Siehe ausführlichen Bericht über die Linie 10
Seit verfolgt der Westberliner Senat den Ausbau des Berliner U-Bahnnetz nach einem General-Aufbauplan: Dem so genannten "200-km-Plan", der vorsah, dass das damals 80 Kilometer lange U-Bahnnetz im Endausbau eine Streckenlänge von 200 Kilometern haben sollte. Neben der Erweiterung der vorhandenen Linien war der bau von drei neuen Linien vorgesehen: Die Linien F, G und H. wurde mit dem Bau der Linie G begonnen, die Nord-südlich verlaufend das Westberliner Zentrum durchqueren sollte. Diese Linie wurde eröffnet und ist die heutige U9. erreichte diese Linien ihren heutigen Ausbau.
Die Linie H dagegen sollte vom Südosten in den Nordwesten führen und hierbei um das Westberliner Zentrum herum führen. Mit dem Bau dieser Strecke wurde begonnen. wurde der erste Abschnitt nach Britz fertig. Der Neuköllner Abzweig der Nord-Süd-Bahn aus den Jahren -30 sollte Bestandteil dieser an sonsten völlig neuen Strecke werden. wurde der bau dieser inzwischen als U7 bezeichneten Strecke abgeschlossen.
Nie gebaut dagegen wurde die Linie F, sie sollte vom Nordosten Berlins in den Südwesten führen und den Alexanderplatz berühren. Dabei war ein Baubeginn eine Zeit lang ernsthaft vorgesehen. dachte man an einen baldigen Baubeginn zwischen Alexanderplatz und Kleistpark. Die Weltwirtschaftskrise verhinderte den für vorgesehenen Baubeginn. In den späten 60ern wurde der Bau beiderseits der Grenze wieder aktuell: Der Westen plante den Bau vom Kulturforum unter der Bundesstraße 1 bis nach Steglitz. Zu beiden Seiten waren Verlängerungen vorgesehen: Nach Lichterfelde (Drakestraße) sowie in das Stadtzentrum wenn es zu einer Wiedervereinigung Berlins kommen würde. Da dies aber seitens des Senats als ausgeschlossen angesehen wurde, dachte man an eine Verschwenkung zur Kochstraße nach: Diese U-Bahnlinie hätte dann unter der Kochstraße Ecke Friedrichstraße ihren Endpunkt erhalten.
Im Osten dagegen war der Baubeginn dieser Linie für vorgesehen. Sie sollte zunächst am Alexanderplatz beginnen und nach Weissensee führen. Zu diesem Zweck wurden beim Umbau des Alexanderplatzes Ende der 60er Jahre sogar schon die Startschächte für die Bohrschilde erstellt. Die DDR erkannte allerdings, dass der Bau dieser U-Bahnlinie die ökonomischen Möglichkeiten überschritten hätte. Letztlich wurde das Projekt langfristig zu den Akten gelegt.
In Westberlin dagegen war der Baubeginn Anfang der 80er Jahre in greifbare Nähe gerückt: um sollte mit dem Bau zwischen Walther-Schreiber-Platz und Kurfürstenstraße begonnen werden. Ende aber gab es für alle Beteiligten die überraschenden Fortschritte in den S-Bahnverhandlungen. Die ostzonale S-Bahn Westberlins ging am 9. Januar von der Deutschen Reichsbahn in die Hände der Westberliner BVG über. Somit stand einer Wiedereröffnung der stillgelegten Wannseebahn nichts mehr im Wege: Die für die Linie F bereitstehenden Mittel flossen in den Wiederaufbau der S-Bahn. Zumal die Wannseebahn parallel zur geplanten Linie F verläuft, verschwand diese U-Bahnlinie bald in den Schubladen. heute denkt niemand mehr an den bau der Linie F, die eine zeitlang den Planungstitel "Linie 10" trug.
Als in den 60ern und 70ern das U-Bahnnetz massiv erweitert wurde, wurden die entsprechenden Bauwerke für die Linie 10 gleich mit erstellt.
Am Kleistpark, unter dem Innsbrucker Platz und unter der Schlosstraße wurden die Bauwerke für die U10 gleich mit erstellt.
Hier rechnete man beim Bau der U7 mit einem starken Umsteigeverkehr zur U10. Aus diesem Grunde erhielt der U-Bahnhof Kleistpark eine bemerkenswert großzügige Fußgängerebene.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Unter dem Bahnsteig der U7 wurde im Zuge der Potsdamer- und Hauptstraße der komplette Bahnsteig für die U10 mit erstellt.
Als in den Jahren bis die Schöneberger Untergrundbahn entstand, rechnete man mit dem Bau einer U-Bahn im Zuge der Haupt- und Rheinstraße eines fernen Tages. Aus diesem Grunde erhielt der Kehrgleistunnel südlich des Innsbrucker Platzes, der Eisacktunnel, eine unterirdische Hilfsbrücke. Diese verdeckte Brücke sollte gewährleisten, dass eines Tages ein zusätzlicher U-Bahntunnel unter dem bestehenden gebaut werden kann, ohne dass der alte Tunnel zu diesem Zweck abgerissen werden muss. Die Geschichte zeigt, dass dieses Stützkorsett nicht notwendig war: Der Westberliner Senat plante seit den 50er Jahren den Ausbau eines Stadtautobahnsystems. Diese Autobahn sollte den Innsbrucker Platz unterqueren. Allerdings war hierzu der alte Eisacktunnel in der Quere, er musste abgerissen werden. wurde der Tunnel stillgelegt und ab beseitigt. Der Innsbrucker Platz, eine Platzanlage mit Verkehrskreisel, verwandelte sich in eine riesige Baugrube. Unter der Platzanlage entstand eine umfangreiche Fußgängerebene als Zugang zum Bahnsteig der U4. In dieser Ebene befindet sich auch der neu eröffnete Lidl-Markt. Unter dieser Ebene befindet sich der 6-spurige Tunnel der Stadtautobahn. Unter der Autobahn wurde vorsorglich bereits ein weiterer U-Bahnhof erstellt. Er befindet sich mit seinem Mittelbahnsteig im Zuge der Haupt- und Rheinstraße.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Zusätzlich wurden alle verbindende Treppen mit erstellt. Heute ist dieser U-Bahnhof ohne jede Funktion. Da der Bau dieser U-Bahnlinie aus den Planungsunterlagen gestrichen wurde, gilt dieser Bahnhof als langfristige Invest-Ruine.
1969 begannen unter der Schlossstraße die Bauarbeiten zur Verlängerung der Linie 9. Sie sollte über Walther-Schreiber-Platz hinaus bis zum Rathaus Steglitz verlängert werden. Fernzukünftig war vorgesehen, die Linie 9 nach Lankwitz weiter zu führen. Dies bedeutete aber, dass die U-Bahn südlich des Hermann-Ehlers-Platz die S-Bahn unterqueren sollte um in die Mittelstraße zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt entstand entlang der Wannsee-S-Bahn eine Autobahn-Zweigstrecke. Am Hindenburgdamm Ecke Schlossstraße entstand eine großzügige Autobahnauffahrt, die eine komplette Umgestaltung der Kreuzung bedeutete. Die Gelegenheit wurde genutzt, um den Streckentunnel der U10 mit zu erstellen. Somit reicht der U10-Streckentunnel bis zum Hindenburgdamm. Dieser Tunnel erhielt zusätzlich Platz für Kehrgleise. Um diesen Tunnel nicht ungenutzt zu lassen, erfuhr er gleich einen Endausbau und wurde ab für die U9 genutzt. Auf diese Weise konnte man sich den Bau eines Kehrgleistunnels unter der engen Mittelstraße östlich der S-Bahn und die S-Bahn-Unterfahrung selbst sparen. Da über dem zukünftigen U-Bahnhof ein Hochhauskomplex zusammen mit einem Bus-ZOB gebaut werden sollte, wurde der U-Bahnhof in komplettem Umfang erstellt. Er besitzt daher heute einen Mittelbahnsteig, der direkt unter dem Hochhbaus liegt und von der U9 genutzt wird, langfristig aber für die U10 vorgesehen war. Der zweite Bahnhofsbereich besitzt zwei Seitenbahnsteige, die nach ursprünglicher Planung für die Lankwitzer U9 gedacht war. Dieser Bauabschnitt wurde nur im Rohbau erstellt und blieb es bis heute.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Um wurde der U-Bahntunnel geringfügig erweitert und endet jenseits der S-Bahn unmittelbar vor der beginnenden Mittelstraße. Diese Erweiterung geschah vor dem Hintergrund, dass der Bau der U9 nach Lankwitz kurzfristig geplant und als "vordringlich" eingestuft war. Nach der Wiedervereinigung verfolgte man andere Pläne: Andere U-Bahnstrecken wie die "Kanzler-U-Bahn" waren nun wichtiger. Die Lankwitzer Strecke war nicht mehr aktuell und galt als langfristiges Projekt. Bei diesem Status blieb es bis heute.
Insgesamt wurde die Strecke unter der Schlossstraße baulich für vier Gleise vorgesehen, wobei je zwei Gleise übereinander zu liegen kommen. Auch der Bahnhof Schlossstraße bietet bereits für beide Linien den ausreichenden Platz und ist voll ausgebaut, da beide übereinander liegenden Bahnsteige genutzt werden. Dieser bahnhof war als der eigentliche Umsteigebahnhof zwischen der U9 und U10 gedacht, da hier beide Linien in die gleiche Richtung am selben Bahnsteig halten sollten. Es wäre also nur ein Überqueren den Bahnsteigs nötig gewesen, um von der einen in die andere Linie gleicher Richtung umzusteigen. In Wahrheit nutzen bereits in diesem Bahnhof die Züge der U9 die Gleisbetten der U10. Zwischen Walther-Schreiber-Platz und Schlossstraße wechseln die U9-Züge die Gleislagen.
Die Richtungs-treue Lage der Bahnsteiggleise im Bahnhof Schlosstraße erforderten ein sehr kompliziertes Überwerfungsbauwerk in Höhe der Muthesiusstraße: Das Bauwerk wurde so angelegt, dass es eine Breite von drei Gleisen einnahm. das westliche Gleis war für die spätere U9 nach Lankwitz gedacht und wies Richtung Süden eine Steigung auf. Das östliche Gleis dagegen hat ein Gefälle Richtung Süden und dient der U10 Richtung Zentrum. In der Mitte haben zwei Gleise exakt übereinander Platz: Das Untere für die U10 nach Lichterfelde und das Obere für die U9 zum Zoo.
Kurz vor dem Walther-Schreiber-Platz Richtung Norden trennen sich beide Linien wieder. Die U9 folgt im weiteren Verlauf der Bundesallee und die U10 sollte der Rheinstraße folgen. Die südliche Vorhalle des Bahnhofs Walther-Schreiber-Platz wurde bereits voll ausgebaut. Direkt unter dieser Vorhalle finden die U10-Tunnel ihr bauliches Ende. Somit existiert in diesem U-Bahnhof noch kein Meter Bahnsteig für die U10.
In den 30er Jahren beschoss die Reichswasserstraßen-Verwaltung einen Neubau der Schleuse am Mühlendamm in Berlins Innenstadt. Mit den Bauarbeiten wurde um begonnen: zunächst musste ein Beipass-Kanal geschaffen werden, damit die Schifffahrt nicht unterbrochen werden brauchte. Dies war Voraussetzung, denn eine Umleitung des Schiffsverkehrs etwa durch den Landwehrkanal kam nicht in Frage, da in der Nähe des Gleisdreiecks die Unterfahrung der Nord-Süd-S-Bahn-Strecke unter dem Landwehrkanal vorbereitet wurde.
Im Zuge des Mühlendamms dagegen war der Bau einer U-Bahnlinie vom Alexanderplatz über Potsdamer Platz zum Kleistpark vorgesehen. (Siehe Planungen ) Um einen späteren Umbau im Bereich der Schleuse wegen des U-Bahnbaus zu vermeiden, sollte der U-Bahn-Tunnel im Bereich der Spree sofort mit erstellt werden.
1937 begannen die Bauarbeiten an diesem Tunnelfragment und der darüber liegenden neuen Schleuse.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
In Bildmitte blau dargestellt: Der ehemalige Mühlendamm-Tunnel
Bedingt durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geriet das Projekt ins stocken. Da der Bau der Schleuse als "kriegswichtig" eingestuft wurde, hat man den Bau nicht abgebrochen, wie dies bei anderen vergleichbaren Projekten geschah, sondern weiter geführt. Gegen wurde der Bau der Schleuse fertiggestellt. In diesem Zusammenhang musste auch die Mühlendammbrücke abgerissen werden. Sie jedoch wurde nicht wieder aufgebaut, es blieb bis in die 60er Jahre bei einem Bauprovisorium. Der U-Bahntunnel dagegen wurde unterhalb des Südufers fertig gestellt. Die Fortsetzung zum Nordufer sollte anschließend gebaut werden, fand aber nicht mehr statt. Es blieb bei dem etwa 100 Meter langem Tunnelbauwerk. Im Bereich der zusätzlich eingebauten Wehrkammer wurde ein Notausgang als einzige Zugangsmöglichkeit errichtet. Dieser Zugang befand sich etwa an der Straßenecke Gertraudenstraße/Mühlendamm auf einem nicht bebauten Grundstück.
In der Zeit nach Fertigstellung des Tunnelkörpers bis Kriegsende nutzte die Rüstungsindustrie diesen Raum als Produktionsstandort für Flugzeugmotoren. Danach hatte der Tunnel keine Funktion. In den 60er Jahren beabsichtigte der Magistrat von Berlin zusammen mit der BVG-Ost den Bau einer U-Bahnlinie zumindest bis zur Leipziger Straße. Das Tunnelfragment sollte Bestandteil der neuen Strecke werden. Doch, es passierte nichts. Nach der Wende gehörte das Eckgrundstück dem Land Berlin, das es weiterverkaufen wollte. Inzwischen steht dort ein Bürogebäude. Bevor dieses aber gebaut werden konnte, musste geklärt werden, was mit dem U-Bahntunnel geschehen sollte. Schließlich würde sich das damals geplante Bürohaus auf dem U-Bahntunnel stützen. Die BVG winkte ab und meinte das die immer noch geplante U-Bahnlinie in Parallelführung als Schildvortriebsstrecke erstellt werden soll - wann auch immer das sein wird. Somit hatte der U-Bahntunnel jede -auch zukünftige- Aufgabe verloren. Daher beschloss die Stadt Berlin den Tunnel mit Beton zu verfüllen. Auf diese Weise ist der Mühlendammtunnel im Sommer dauerhaft unbrauchbar und in einen riesigen unterirdischen Betonklotz verwandelt worden.
Potsdamer-Platz-Tunnel und U-Bhf. Stadtmitte
Im Zusammenhang mit der Bebauung des Potsdamer-Platz-Areals in den Jahren bis entstand unterirdisch ein gigantisches Schienen-Kreuz: Nord-Südlich wurde der Tiergarten-Tunnel gebaut. In diesem Zusammenhang entstand unter dem Potsdamer Platz ein viergleisiger Regionalbahnhof, der parallel westlich der S-Bahn liegt. Dieser Bahnhof kann bereits besichtigt werden, wenn man von der S-Bahn zur Alten Potsdamer Straße möchte. Auffallend in diesem Bahnhof ist die auf einen kurzen Abschnitt riegelartig heruntergezogene Decke. In diesem Bauriegel befindet sich ein kompletter U-Bahntunnel.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Dieser Tunnel ist bestimmt für die zukünftige Linie U3, die dereinst von Weissensee zum Adenauerplatz führen soll. Hierbei handelt es sich um eine langfristige Bauvorleistung, denn derzeit ist völlig offen, ob und wann diese U-Bahnlinie überhaupt gebaut werden soll. Um den Tunnel zwischenzeitlich zu nutzen wurde angeregt, die in diesem Bereich geplante Straßenbahn durch diesen Tunnel zu führen. Da aber selbst Straßenbahnen in dieser Gegend noch Zukunftsmusik sind, wird der Tunnel auf absehbare Zeit keine Nutzung erfahren. Abgesehen davon, dass an beiden Tunnelenden Rampenbauwerke errichtet werden müssten. Im Falle aber einer Straßenbahnnutzung wird angestrebt, diesen Tunnel unter der gesamten Leipziger Straße entlang bis zum Spittelmarkt auszubauen. Am U-Bahnhof Stadtmitte würde diese Bahn dann den Bahnsteig der U6 im 90-Grad-Winkel unterqueren. Bereits beim Bau des Bahnhofs Stadtmitte in den 20er Jahren wurde eine Unterquerung durch eine Leipziger-Straßen-U-Bahn baulich vorbereitet: Der Bahnhof besitzt eine unterirdische Hilfsbrücke.
Doch zurück zum U-Bahnhof Potsdamer Platz: Der neue U-Bahntunnel reicht vom Leipziger Platz bis etwa zur Ludwig-Beck-Straße im Zuge der neuen Potsdamer Straße. Bestandteil ist ein U-Bahnhof mit Mittelbahnsteig, der lagetreu über dem Regional- und dem alten S-Bahnhof liegt. Im S-Bahnhof ist hierzu bereits eine Baufreiheit seit seiner Erbauung gegeben. Außerdem wurden Aufzüge zwischen U-Bahnsteig und beiden S-Bahnsteigen baulich vorbereitet. Östlich des Bahnhofs wird sich eine Rampe anschließen, da der Bahnhof der U2 von unterquert werden muss.
Die BVG und das Land Berlin meinten es gut, und wollten unserem Bundeskanzler eine eigene U-Bahnlinie spendieren...
Diese U-Bahnplanung ist mittlerweile nur noch als ein großes Desaster zu bezeichnen:
Es war vorgesehen die U-Bahnlinie U5 ab Alexanderplatz im Rahmen der alten 200-Kilometer-Pläne des Westberliner Senats Richtung Moabit zu erweitern. Wir erinnern uns: Schon Ernst Reuter regte den Bau einer U-Bahn nach Moabit an, allerdings sollte jene Strecke vom Halleschen Tor kommen. Doch zurück zu unserer Kanzler-U-Bahn. Westlich des Bahnhofs Alexanderplatz sollte die neue Strecke an die Vorhandene anknüpfen. Die Bahn sollte zunächst der Rathausstraße folgen, am Rathaus selbst einen Bahnhof namens "Berliner Rathaus" erhalten. Danach sollte die Strecke nach Westen abzweigen und den Schlossplatz unterqueren. Dort war ein weiterer Bahnhof vorgesehen. Voraussichtlich sollte er "Schlossinsel" oder "Lustgarten" heißen. Weiter ging es unter den Linden entlang mit je einem Bahnhof unter der Friedrichstraße und neben dem S-Bahnhof "Unter den Linden" Danach sollte die Strecke im weitem Bogen vom Brandenburger Tor bis zum Lehrter Bahnhof geführt werden und dort zunächst enden. Später sollte die Strecke nach Unterquerung des Fritz-Schloss-Parks bis zur Turmstraße erweitert werden und dort Anschluss an die U9 finden.
Wegen der Erstellung der Bundesbauten und des Lehrter Bahnhofs wurde der Bau der Kanzler-U-Bahn in diesen Bereichen vor einigen Jahren begonnen. Sehr euphorisch ging man an diese Arbeiten, man glaubte in Senatskreisen, dass die komplette rund 5 Kilometer lange Strecke bis fertig sein würde. Danach begann das große Zaudern, da man nämlich erkannt hat, dass diese U-Bahnstrecke sehr viel Geld kosten würde. Es wurde ständig hin und her überlegt, ob mit dem Bau der Strecke nun begonnen werden sollte oder nicht. Inzwischen war eine Eröffnung in illusorisch, man sprach längst von ferneren Jahren, war schon im Gespräch. Doch dann platzte die Bank-Affäre dazwischen, die der Stadt zusätzliche Milliarden-Defizite bescherte. Binnen weniger Tage wurde die U-Bahnplanung zu den Akten gelegt. Der Bau rückt in weite Ferne, inzwischen ist auch nicht mehr aktuell. Dennoch wurde auf einem Abschnitt mit dem Bau begonnen: Zwischen dem Hotel Adlon und dem Lehrter Bahnhof wurde der komplette Rohbau seit erstellt. Diese Arbeiten fielen zusammen mit dem Bau des Tiergartentunnels, dem Umbau des Reichstags und dem Bau des Bundeskanzleramtes. das war sinnvoll, da dann ein nochmaliges Aufreißen des Bodens verhindert wird, da der Tunnel dann bereits fertig ist.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Der Tunnel der Kanzler-U-Bahn hat etwa eine Länge von derzeit 1,6 Kilometern. Er beginnt unter dem Pariser Platz als Schildvortriebsstrecke mit zwei eingleiseigen Röhrentunneln. Hierbei wird das Brandenburger Tor unterquert und anschließend die Grünanlagen des Tiergartens im bereich des Sowjetischen Ehrenmals. Anschließend mündet der U-Bahntunnel in das Gemeinschaftsbauwerk des Tiergartentunnels ein und verläuft parallel zu den übrigen Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Für die U-Bahn gibt es in diesem Bereich den Bahnhof "Reichstag", der im Rohbau ebenfalls komplett fertiggestellt ist. Der fertige Neubautunnel findet sein Ende nördlich der Spree-Unterfahrung. Im Anschluss derzeit der Lehrter Bahnhof im Bau, in dessen unterster Ebene ebenfalls ein U-Bahnhof entsteht. In Höhe der Invalidenstraße findet der U-Bahntunnel mittelfristig sein Ende.
Seit nun wird diese U-Bahnlinie zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof (Lehrter Bahnhof) fertiggestellt.
In dem Bereich, wo heute die Rohbauten für die
Kanzler-U-Bahn existieren, hat es schon mal Rohbautunnel gegeben bzw. gibt es
sie noch heute:
stellte der Generalbauinspektor Speer seine "Umgestaltungspläne"
Berlins vor. Herausragende Baumaßnahme war die sogenannte
"Nord-Süd-Achse", die am Reichstag bei der geplanten Großen Halle
beginnen und nach Marienfelde führen sollte. An dieser Achse sollten
gigantische Bauten für Behörden und Verwaltungen entstehen. Der geplanten
"Großen Halle" sollte das gesamte Alsenviertel geopfert werden.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Umgebung des Reichstages mit den beiden U-Bahntunneln und schematische
Darstellung der Nord-Süd-Achsen-Planung.
In diesem Zusammenhang waren zwei U-Bahnprojekte vorgesehen: Linie E: Diese Linie sollte nach der Planung von vom Alexanderplatz nach Moabit (Beusselstraße) verlängert werden. Die zweite Linie war die Linie G, sie sollte von Lübars unter der Nord-Süd-Achse bis nach Marienfelde gebaut werden. Diese Linie G hatte nichts mit der in den 50ern gebauten Linie G zu tun. Hier am Reichstag jedenfalls hätten sich diese beiden Linien berührt. wurde mit dem Bau von zwei Tunneln begonnen: Der eine Tunnel, zur Linie G gehörig, reichte von der Südseite der heutigen Straße des 17. Juni bis fast zur Scheidemannstraße und liegt fast genau unter dem sowjetischen Ehrenmal. Der Tunnel hat eine Länge von etwa 200 Metern und besitzt nur einen Zustieg. Dieser Tunnel existiert noch heute.
Ein zweiter Tunnel entstand nordwestlich des Reichstages unter der heutigen Paul-Löbe-Straße. Auch dieser etwa 225 Meter lange Tunnel entstand ab . Beide Projekte wurden abgebrochen aufgrund des Krieges. Der Paul-Löbe-Tunnel aber wurde gesprengt und später verschüttet. Bei den Bauarbeiten des neuen Tiergartentunnels (u.a. für die U5) dürften die Reste dieses Tunnels beseitigt worden sein.
Heerstaßen-Tunnel
Bauprojekt U-Bahnhof Mussoliniplatz
Im Rahmen der Planungen zur Umgestaltung der Reichshauptstadt war eine erhebliche Erweiterung des U-Bahnnetzes vorgesehen. So sollte eine U-Bahnstrecke von der Zoogegend durch die Kantstraße und weiter nach den heutigen Theodor-Heuss-Platz geführt werden. Hier war aber keineswegs eine Endstation geplant, nein die Strecke sollte anschließend durch die Heerstraße geführt werden und dann in der Gegend des heutigen Scholzplatz die sogenannte "Hochschulstadt" erreichen. Dort sollte sich die Strecke teilen, so der Planungsstand . Eine Strecke sollte weiter nach Spandau führen und die andere in die neuen geplanten Stadtteile bei Gatow/Kladow. Grundsätzlich sei hier angemerkt, dass diese Planungen alle noch sehr schwammig waren, da gerade nach noch viele Umplanungen und Korrekturen stattfanden.
Letztlich machte der begonnene 2. Weltkrieg die weiteren Planungen ohnehin hinfällig.
Am damaligen "Adolf-Hitler-Platz" jedenfalls wurde mit dem Bau von U-Bahnanlagen begonnen. Hierbei handelt es sich um den heutigen Theodor-Heuss-Platz, der nach damaliger Planung in "Mussoliniplatz" umbenannt werden sollte. Die Bauarbeiten begannen am Westende des Platzes, wobei im Bereich am Anfang der Heerstraße sogar schon ein kurzes Tunnelstück fertig wurde. Es entstand auf dem damals unbebauten Grundstück der heutigen Häuser Heerstraße 4 und 4a und war für die Linie A bestimmt.
Folgendes war vorgesehen:
Auf der Südseite des Platzes sollte ein viergleisiger U-Bahnhof entstehen, der
über zwei Mittelbahnsteige verfügen sollte. Die äußeren Gleise waren für
die Linie Richtung Kantstraße/Heerstraße bestimmt, wobei die inneren Gleise
für die Linie A nach Ruhleben bestimmt waren. Vor und hinter dem Bahnhof sollte
je ein Ausfädelbauwerk entstehen. Außerdem war ein U-Bahntunnel vorgesehen von
der Heerstraße unter der Bebauung durch zur Reichsstraße hinüber, dieser
Tunnel sollte in Höhe der Kastanienallee in den A-Linientunnel unter der
Reichsstraße einmünden. Ein vergleichbarer Tunnel war östlich des
Adolf-Hitler-Platzes vorgesehen: Von der Süd-Ost-Seite/Masurenallee unter dem
heutigen SFB hindurch bis zur Soorstraße Ecke Kaiserdamm. Dort war die
Einfädelung in die bestehende Strecke vorgesehen. Der alte Streckentunnel der
Linie A zwischen Soorstraße und Kastanienallee inklusive dem Bahnhof sollte
stillgelegt werden.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Auch am Anfang der Heerstraße wurde mit Erdausschachtungen begonnen. Der Krieg aber beendete die Arbeiten gegen . Um wurde die Baustelle wieder verfüllt und die Rammträger gezogen. Sie fanden dann Verwendung auf dem Wedding bei der Müllerstraßen-U-Bahn (C-Nord) Der existierende Tunnel unter den Häusern an der Heerstraße soll heute Bestandteil der Kelleranlagen sein.
ICC-Tunnel unter der Kantstraße
Die Linie in der Kantstraße war auch nach dem Krieg noch nicht vom Tisch. Sie wurde in den 200-Kilometer-Plänen des Bausenats festgeschrieben, allerdings sollte sie nicht gradlinig unter der Kantstraße verlaufen (U-Bhf. Wilmersdorfer Straße U7 erhielt beim Bau eine Hilfsbrücke für alle Fälle), sondern sollte über den Adenauerplatz abgeschwenkt werden und an der Uhlandstraße in die U3 (heute U15) münden.
Beim Bau des Internationalen Congress-Centrum ICC am Messedamm entstand unter der Straßenkreuzung Neue Kantstraße/Masurenallee/Messedamm eine sehr großzügig bemessene Fußgängerunterführung. Im Zusammenhang mit dieser Fußgängerebene entstand darunter bereits ein Bahnhofsfragment für einen U-Bahnhof namens "Messedamm". Es ist durchaus möglich, dass auch unter der Stadtautobahn bereits ein U-Bahntunnel liegt. Die Stadtautobahn entstand um /60.
Der Tunnel unter dem Adenauerplatz
Im Zusammenhang mit den vorgenannten Planungen und im Zusammenhang mit dem Bau der heutigen U7 entstand im Zuge des Kurfürstendamm ein Bahnhofsfragment unterhalb des U7-Bahnsteigs. Dieser Bahnsteigtunnel erstreckt sich nicht nur quer unter dem Bahnhofsbauwerk der U7 sondern reicht bis unter den benachbarten Straßentunnel, der die Brandenburgische Straße mit der Lewishamstraße verbindet. Außerdem wurde der Tunnel der U-Bahn so angelegt, dass noch Platz für einen weiteren Straßentunnel besteht. Dieser weitere Straßentunnel soll den Kurfürstendamm mit der Lietzenburger Straße verbinden und hierbei am Olivaer Platz als Rampe enden. Diese Straßenplanung allerdings dürfte heute nicht mehr aktuell sein.
Beim Bau der Linie G, der heutigen Linie U9 in den Jahren bis wurde im Bereich des Bahnhofs Turmstraße bereits der Bau der heutigen Linie U5 mit vorbereitet. Hierzu entstand ein Teil der Bahnhofshalle mit Mittelbahnsteig quer über dem Bahnsteig der Linie U9 gleich mit. Dies ist auf dem Bahnsteig der U9 an der im Mittelteil heruntergezogenen Decke erkennbar. Außerdem wurde ein Treppenkreuz mit eingebaut. Die nördliche Treppe dieses Kreuzes auf dem Bahnsteig der U9 kann man in dem dortigen Kiosk erkennen. Die südliche Treppe dagegen war jahrzehntelang hinter einer Wand verborgen. Erst vor wenigen Jahren wurde die Treppe freigelegt und kann heute genutzt werden. Sie führt zu einem neu angelegten mittleren Ausgang. Zwischen der unteren Treppe zum Bahnsteig und der oberen Treppe zum Ausgang durchschreitet man einen kurzen Gang. Ohne es zu merken befindet man sich in diesem Gang auf dem Bahnsteig der U5!
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Ein recht ausgedehntes Tunnelbauwerk befindet sich am U-Bahnhof Jungfernheide der U7. Der Bahnhof Jungfernheide wurde zwischen und gebaut, wobei er baulich bereits für die Aufnahme der zukünftigen U5 vorbereitet wurde. Aus diesem Grunde besteht der Bahnhof aus zwei deckungsgleich übereinander liegenden Bahnsteigen, wobei nur die westlichen Bahnsteigkanten von der U7 genutzt werden. Die östlichen Kanten, derzeit noch hinter einem roten raumhohen Gitterwerk verborgen, sollen von der U5 genutzt werden, die vom Alexanderplatz kommend bis zum Flughafen Tegel reichen soll.
Südlich des Bahnhofs Jungfernheide umfasst das Bauwerk nur den sichtbaren Teil der Ausfädelung unter dem Gallesteig. Nördlich dagegen ist das Bauwerk erheblich umfangreicher: Es besteht aus zwei unabhängigen Tunnelstümpfen, die bis unter dem Westhafenkanal hindurch reichen, ja sogar bis fast zum Reichweindamm reichen. Hierdurch konnte nach dem Bau der U-Bahn die darüber gelegene Stadtautobahn zur Seestraße gebaut werden. In der Paul-Hertz-Siedlung dagegen existiert noch kein Tunnel, aber dafür ist die Streckentrasse innerhalb einer Grünanlage frei gehalten.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Es gab immer wieder Überlegungen, die U-Bahn zum Flughafen Tegel auszubauen. Doch nun scheint es sicher, dass der Flughafen zugunsten des Großflughafens Schönefeld geschlossen werden soll. Danach stellt sich die Frage, was aus dem Areal werden soll. Möglicherweise bleibt eine U-Bahn dorthin in späteren Zeiten aktuell.
Der Westhafenkanal-Tunnel war in den vergangenen Jahrzehnten ohne Funktion. Derzeit werden in diesem Tunnel von Gleisbau-Azubis der BVG Gleise angelegt. Diese Gleisanlagen werden zu Übungszwecken in Tunnelanlagen für die Berliner Feuerwehr dienen.
Genthiner Tunnel und Wittenbergplatz-Abzweig
Zwischen und entstand unter dem Nollendorfplatz ein neuer Umsteigebahnhof. Wesentliches Interesse an diesem Bahnhof hatte die bis selbständige Stadt Schöneberg: Hierdurch entstand nämlich ein Gemeinschaftsbahnhof der eigenen U-Bahn und der U-Bahn der Hochbahngesellschaft. Die Züge der Stadt Schöneberg sollten nämlich, so plante es die Stadt auf neuen Wegen durch das Tiergartenviertel in die Berliner Innenstadt fahren.
Lange Geschichte kurzgefasst: Es wurde nichts mit den Schöneberger U-Bahnplänen einer Innenstadt-Anbindung. Die Züge aus Richtung Hauptstraße erreichten den Bahnhof Nollendorfplatz (mittlerer Bahnsteig) zwar auf eigenen Gleisen, fuhren dann aber hinter dem Bahnhof auf das Gleis Richtung Warschauer Brücke rüber. Umgekehrt hielten die Züge zum Innsbrucker Platz auf dem westlichen Gleis des untersten Bahnsteiges und zweigten erst südlich des Bahnhofs Nollendorfplatz ab. Das östliche Gleisbett blieb damals leer. Desgleichen befand sich unter der Kreuzung Kurfürstenstraße/Genthiner Straße ein Streckenabzweig, der ohne jede Funktion war. Somit war es damals noch nicht mal möglich, am Nollendorfplatz Züge abzustellen.
Um zeichnete sich ab, dass in Kürze unter dem Innsbrucker Platz die Kehrgleisanlage beseitigt werden muss, da dort der Bau einer Stadtautobahn geplant war. Die Kehranlage Innsbrucker Platz war die einzige Kehranlage der U-Bahnlinie 4. Da diese Kehranlage nun beseitigt werden sollte, musste schleunigst eine neue Kehranlage her: Unter der Genthiner Straße bot sich ein Tunnel dafür an, zumal die notwendige Abzweigung vorhanden war.
In der Folgezeit entstand ein etwa 350 Meter langer Tunnel, der bis zum Magdeburger Platz reicht. In ihm wurden daraufhin Gleise verlegt, wobei die Gelegenheit genutzt wurde, die gesamte Gleisanlage dieses Bahnhofs umzugestalten.
Heute werden nur in seltenen Fällen Züge in diesem Tunnel abgestellt, Kehrfahrten der U4 jedenfalls finden dort nicht statt, die U4-Züge kehren am Bahnsteig.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Lageplan mit dem Genthiner Tunnel und dem Wittenbergplatz-Abzweig unter der
Urania/Kleiststraße.
Als der Bahnhof Wittenbergplatz zwischen
und im heutigen Sinne entstand, sollte er Verzweigungen nach Westen in drei
Richtungen bieten: Zum Zoo, nach Wilmersdorf und zur Uhlandstraße.
Nach Osten dagegen waren ebenfalls drei Verzweigungen vorgesehen: Zum
Hochbahnhof Nollendorfplatz, die damals schon vorhanden war, die zweite
Verzweigung führte zum unterirdischen Bahnhof Nollendorfplatz und entstand mit
der Entlastungslinie bis . Die dritte Verzweigung dagegen ist nie
entstanden. Sie sollte durch die Urania Richtung Lützowplatz führen. Um diese
Ausfädelung möglichst leicht nachträglich einzufügen, entstand bereits ein
kurzer Quertunnel unter den bestehenden Bahnanlagen hindurch: Dieser Tunnel ist
eingleisig, beschreibt eine leichte Kurve und reicht vom südlichsten, heute von
der U1 benutzten, Gleis bis unter dem nördlichsten, ebenfalls von der U1
genutzten Gleis hindurch. Der Tunnel liegt unter der Kleiststraße in Höhe der
Urania unter der großen Kreuzung.
Dieser Tunnel ist heute ohne jede Funktion, da er zu beiden Seiten keine Tunnelanbindung besitzt.
Der kreuzende Bahnsteig unter dem Moritzplatz
Zusammen mit dem Bahnhof Moritzplatz im Zuge der Linie D entstand im rechten Winkel zum D-Linien-Bahnsteig ein Bahnhofsbereich in einer untergeordneten Ebene. Dieser Bahnsteig war anfänglich für eine U-Bahnlinie von Neukölln/Treptow nach Moabit gedacht. Diese Linie plante man aus damaliger Sicht für die mittelfristige Zukunft. Aufgrund der Umgestaltungspläne des Dritten Reiches im Jahre verschwand diese Planung aus den Unterlagen. Seither war dieses Bahnhofsfragment für eine unterirdische S-Bahnlinie vorbehalten. Es handelt sich hierbei um die S-Bahnverbindung Anhalter Bahnhof - Görlitzer Bahnhof. Man ging davon aus, dass in diesem Tunnel für die gegenüber dem U-Bahn-Großprofil breiteren S-Bahnzüge genug Platz wäre.
Es ist im Laufe der Geschichte zu keiner der Schnellbahnbauten gekommen, auch derzeit ist in diesem Bereich keine U- oder S-Bahn vorgesehen. Jahrzehntelang war der Bahnsteigtunnel daher ohne Funktion. richtete die BVG in diesem Tunnel ein Unterwerk zur Versorgung der U-Bahn ein und nutzt diesen Tunnel in der Form noch bis heute.
Der Dresdener Tunnel
Um bis 17 ist in der Dresdener Straße ein U-Bahntunnel entstanden, der ebenfalls heute nicht mehr genutzt wird. Dieser Tunnel war für die AEG-Schnellbahn gedacht und reicht von der heutigen Heinrich-Heine-Straße bis zum Alfred-Döblin-Platz. Unter dem Platz gibt es sogar einen Bahnhof: Den U-Bhf. Dresdener Straße. Auf diese Weise sollte die Bahn auf direktem Wege von der Jannowitzbrücke zum Kottbusser Tor führen, wobei im weiteren Verlauf der Oranienplatz unterquert werden sollte. Nun war es aber August Wertheim, der am Moritzplatz eines seiner Warenhäuser besaß. Er wünschte sich einen U-Bahn-Anschluss. Und um die Entscheidung für den Berliner Magistrat zu vereinfachen, legte er noch 5 Millionen RM drauf und die Stadt plante um. Als um der Bau der GN-Bahn wieder aufgenommen wurde, hat man das Tunnelfragment nicht mehr weiter gebaut, sondern gradlinig Richtung Moritzplatz weitergebaut.
Der Dresdener Tunnel wurde dennoch genutzt: Die NSAG, Vorläufer der BVG, legte im Dresdener Tunnel ein Gleis an, welches zum Abstellen von Zügen genutzt werden konnte. Um wurde das Gleis demontiert und der Tunnel zu einem öffentlichen Luftschutzraum ungestaltet. Nach dem Krieg wurde der Tunnel nicht mehr genutzt, da er nun im Bereich der Grenze lag. Die Bunkermauern boten sich an, an dieser Stelle den Tunnel hermetisch geschlossen zu halten: Nach dem Bau der Mauer führte dieser Tunnel von Ost- nach West-Berlin. Der West-Berliner Tunnelabschnitt wurde seit den 80er Jahren von der BEWAG genutzt.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
In Neukölln gibt es auch ein Zeugnis überzogener Planungen:
Der Grenzallee-Tunnel
In den 20er Jahren plante der Magistrat unter Ernst Reuter den massiven Ausbau des Streckennetzes der U-Bahn. Hierzu ist auch der Bau von Betriebswerkstätten nötig. Eine dieser Werkstätten war an der Linie C in Neukölln vorgesehen, genauer am Sieversufer neben dem Teltowkanal. Im Dezember wurde die Linie C von Bergstraße (heute: Karl-Marx-Straße) bis zur Grenzallee erweitert, wobei ein Weiterbau Richtung Britz bautechnisch vorbereitet wurde: Hinter dem Bahnhof Grenzallee fallen die Streckengleistrassen steil ab, um den Teltowkanal unter der Buschkrugbrücke zu unterqueren. Unmittelbar nördlich dieser Unterfahrung war der Tunnelbau beendet worden. Erst wurde hier angeknüpft für den Bau nach Britz-Süd. Allerdings wurde das Tunnelbauwerk so gestaltet, dass zwei Kehrgleise nicht in dieser Rampe liegen, sondern waagerecht. Diese Kehrgleise wurden für den alltäglichen Wendebetrieb der U-Bahn bis benötigt. Am Südende zweigt diese Kehrgleisanlage nach Osten ab und verläuft entlang des Nordufers des Kanals. Allerdings wurden in diesem hinteren Bereich keine Gleise verlegt, denn diese Tunneltrasse war als Zuführung zur Werkstatt vorgesehen. Der Tunnel ist derart breit, dass hier vier Gleise Platz finden: zwei für die Zufahrt und zwei weitere an den Außenseiten für Rangierzwecke in der Werkstatt. Am Ostende des Tunnels befinden sich Absperrtore, wo eigentlich das Werkstattgelände ebenerdig beginnen sollte.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Der Bau dieser Werkstatt war, so ist anzunehmen, bald nach Fertigstellung der Grenzallee-Strecke vorgesehen. Nach Beginn der Weltwirtschaftskrise wurden alle U-Bahnplanungen zurückgestellt, so auch der Bau dieser Werkstatt. Das Tunnelbauwerk lag in den ersten Jahren brach, wurde dann aber während des Krieges von der Rüstungsindustrie genutzt. Ab nutzte man sogar die komplette U-Bahnstrecke bis hin zum Bahnhof Bergstraße, weshalb der U-Bahnverkehr entsprechend gekürzt wurde. Erst im Juli konnte der Zugverkehr zwischen Bergstraße und Grenzallee wieder aufgenommen werden, nachdem die Tunnelanlagen geräumt waren. Der Kehrgleistunnel an der Grenzallee wurde damals vom toten Tunnelabschnitt durch eine Mauer getrennt und in späteren Jahren von der BVG als Lagerhalle genutzt.
Der Bau des Werkstatt-Komplexes wurde endgültig in den 50er Jahren verworfen, als die U-Bahn nach Britz-Süd gebaut wurde. In diesem Zusammenhang wurde in Britz der Bau einer neuen Werkstatt vorgesehen, wo mehr Platz zur Verfügung stand. Jene Werkstatt wurde in Betrieb genommen.
Auch in Schöneberg gibt es noch geheimnisvolle Tunnelanlagen:
Der Eisacktunnel und Otzentunnel
Als die Schöneberger Untergrundbahn eröffnet wurde, war sie gleistechnisch von der Berliner Hochbahn unabhängig. Dies hatte zur Folge, dass diese knapp 3 Kilometer lange Linie eine eigene Betriebswerkstatt benötigte. Diese befand sich seinerzeit auf einem Gelände südlich des Innsbrucker Platzes neben der Wannseebahn auf damals freiem Feld. Als Anschluss an die U-Bahnstrecke wurde damals unter der Eisackstraße ein eingleisiger Tunnel angelegt, der in einer S-Kurve von den Kehrgleisen bis zu einer Rampe südlich der Traegerstraße reichte. Die recht steile Rampe befand sich unmittelbar neben der Werkstatthalle.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
In dieser Werkstatt wurde bis der gesamte Schöneberger Wagenpark unterhalten. Um wurde das Areal drum herum allmählich bebaut. So gab es ursprünglich südlich der Werkstatt ein Ausziehgleis, welches den neuen Wohnungsprojekten nun im Wege stand. Als Folge daraus musste dieses Gleis nach süd-westen verschwenkt werden. Damit es für die Anwohner der Häuser an der Baumeisterstraße noch erträglich blieb, wurde dieses neue Ausziehgleis in einen kurzen Tunnel, den Otzentunnel, verlegt. Dieser Tunnel hat eine Länge von etwa 100 Metern.
Nach wurde es in dieser Werkstatt allmählich ruhiger: Die Schöneberger U-Bahn wurde an das übrige U-Bahnnetz angeschlossen. Somit konnten die auf dieser Linie beheimateten Wagen in Grunewald gewartet werden. war hier endgültig Schluss: Bis wurden die Gleisverbindungen zum U-Bahnhof Innsbrucker Platz getrennt und die Werkstattanlage in den folgenden Jahren fremd genutzt. Sehr wahrscheinlich wurden in dieser Zeit alle Gleisanlagen entfernt. Im 2. WK wurde das Gelände schwer verwüstet und blieb lange brach. In den 50er Jahren wurden die Hallenreste beseitigt und es entstand die "Waldenburg-Oberschule". Nur die Kehrgleisanlage südlich des Bahnhofs Innsbrucker Platz blieb erhalten und in Betrieb, während der Eisacktunnel während des Krieges zu einem Schutzraum umgebaut wurde: er erhielt Trennwände, wodurch einzelne Räumlichkeiten entstanden. Der Otzentunnel dagegen wurde nicht weiter genutzt.
Anfang der 70er Jahre wurde mit dem Bau der Stadtautobahn am Innsbrucker Platz begonnen. Der Eisacktunnel war dieser Autobahn im Wege und musste daher auf einem kurzen Abschnitt beseitigt werden. Südlich des Tunnels der Autobahn gibt es heute noch einen verlassenen Rest des Eisacktunnels, der heute ohne jede Funktion ist und keine Verbindung mehr zum U-Bahnnetz hat.
Der Otzentunnel ist
vollkommen in eine Grünanlage eingewachsen und heute nur noch sehr schwer
auszumachen.
Anfang der 80er befand er sich relativ offen zugänglich auf dem Hinterhof der
Wohnhäuser der Baumeisterstraße.

Diese Aufnahme entstand im Frühjahr . Leider war ein
näheres Herankommen aufgrund eines Zaunes nicht möglich.
Weitere Tunnel werden folgen...
10/05
