Betriebsinterne Tunnel
Das Berliner U-Bahnnetz birgt eine ganze Reihe Tunnel, die der normale Fahrgast nie zu Gesicht bekommt. Hierbei müssen zwei Arten von Tunneln unterschieden werden: Die betriebsinternen Tunnel, die heute noch tagtäglich für den internen Gebrauch der BVG benötigt werden und zum anderen die Tunnel, die heute ohne Funktion sind oder niemals eine Funktion für die U-Bahn hatten und als "blinde Tunnel" klassifiziert werden.
Lesen Sie auch den Bericht zu den "blinden Tunneln"
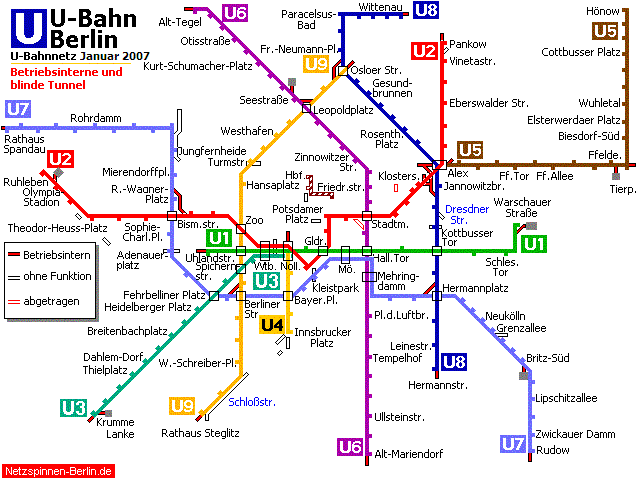
Die betriebsinternen Tunnel:
Betriebsinterne Tunnel sind Streckenabschnitte, die die BVG heute noch benutzt. Dabei handelt es sich entweder um normale Kehrgleistunnel, die sich hinter dem normalen Ende einer Linie befinden, oder es sind Tunnel, die verschiedene U-Bahnlinien miteinander verbinden und nur benötigt werden, wenn Züge ausgetauscht oder Schmierfahrten durchgeführt werden. In jedem Falle aber gelten diese Tunnel als in Betrieb.
Diese Tunnel haben offizielle Namen, die vom Berliner Bausenat vorgegeben sind, an denen sich die BVG orientiert. Die Namen richten sich nach den Bezeichnungen der berührten Linien, wobei nicht die BVG-Linienbezeichnungen zu Grunde liegen, sondern die Planungsbezeichnungen, die auf dem Linienbezeichnungen von basieren. Inoffiziell aber haben sich andere Namen durchgesetzt, zumeist vorgegeben durch unterfahrene Örtlichkeiten.
Der bekannteste Tunnel dürfte der Waisentunnel sein:
1913 begann die AEG mit dem Bau einer Schnellbahn zwischen Gesundbrunnen und Neukölln. Diese Linie wurde in der Folgezeit "GN-Bahn" genannt. Als man mit dem Bau begann, plante man eine Streckenfertigstellung bis . Doch der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Die Folge war, dass sich das Bautempo massiv verlangsamte. Auf weiten Streckenabschnitten wurde der Bau gar nicht erst aufgenommen. Der Bau beschränkte sich zum Beispiel auf den Bereich zwischen Jannowitzbrücke, wo die Spree unterquert werden sollte und der Littenstraße, die damals noch Neue Friedrichstraße hieß. Trotz des Krieges wurde der Bau wenn auch sehr langsam voran getrieben, denn man wollte die komplizierte Spree-Unterfahrung fertig stellen. waren die Bauarbeiten zwischen der Rungestraße und der heutigen Grunerstraße im Rohbau abgeschlossen. Bestandteil dieses Tunnelbauwerks war der Bahnhof "Stralauer Straße".
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der AEG in der Nachkriegszeit führten zur völligen Aufgabe der U-Bahnplanungen, obwohl inzwischen an vier Stellen Rohbautunnel vorhanden waren. (Dresdener Straße, Waisenstraße/Spreetunnel, Liebknechtstraße und Brunnenstraße) Die Stadt Berlin verklagte die AEG auf Fertigstellung dieser U-Bahnstrecke, für die sogar schon Vorserien-Fahrzeuge gebaut wurden. Trotz Klage sah sich die AEG außer Stande, den Bau fortzuführen. Die eigens gegründete AEG-Schnellbahn-AG musste in Liquidation treten, wobei das gesamte Anlagevermögen per Urteil der Stadt Berlin zufiel. gründete die Stadt Berlin die Nord-Süd-Bahn-AG, die ihrerseits mit der Fertigstellung der heutigen Linie U6 beschäftigt war. Die Nord-Süd-Bahn-AG bekam die Aufgabe, das GN-Bahn-Projekt weiter zu führen. Inzwischen bestand ein Betriebsvertrag zwischen der städtischen Nord-Süd-Bahn und der Hochbahngesellschaft als Betreiber der alten Kleinprofillinien. Im gegenseitigen Einvernehmen wurden Untersuchungen durchgeführt, wie die GN-Bahn einen besseren Anschluss an die Hochbahn-eigene Centrumslinie (heutige U2) erhalten könnte. Die AEG nämlich plante einen U-Bahnhof im rechten Winkel der heutigen Rathausstraße und somit in recht großer Entfernung zum seit bestehenden U-Bahnhof Alexanderplatz. Es gab sehr viele Untersuchungsergebnisse, die zur Diskussion standen. Letztlich setzte sich die Variante durch, die einen Streckenneubau von der Jannowitzbrücke bis zur Münzstaße östlich entlang der Stadtbahn bedingte. Dies war die teuerste Variante, aber auch die Vernünftigste, da sie den Bau eines großen Gemeinschaftsbahnhofs unter dem Alexanderplatz möglich machte. Teuer wurde das Ganze auch deshalb, weil eine zweite völlig neue Unterquerung der Spree erforderlich wurde.
1926 wurde mit dem Bau dieser Strecke begonnen, wie auch im selben Jahr mit dem Bau der Friedrichsfelder U-Bahn begonnen wurde: Ein U-Bahnprojekt, das mit der GN-Bahn nichts zu tun hat, wenn man mal davon absieht, dass beide Linien am Alexanderplatz einen gemeinsamen Bahnhof erhielten.
Der alte Streckentunnel durch die Littenstraße schien nun jede Aufgabe verloren zu haben. Doch dem war nicht so! Zwischen der GN-Bahn und der Friedrichsfelder Linie war es betrieblich notwendig, einen Verbindungstunnel zu schaffen, mit dem es möglich wäre, U-Bahnwagen auszutauschen. Für diese Aufgabe bot sich der Waisentunnel an. Er musste nur noch den neuen Gegebenheiten angepasst werden.
Zwischen dem nördlichen Tunnelende in Höhe der heutigen Grunerstraße und dem Abstelltunnel der Friedrichsfelder U-Bahnlinie wurde ein Verbindungstunnel gebaut, der eine enge Kurve beschreibt und aus der heutigen Littenstraße nach Westen abbiegt und somit unter der Rathausstraße in den Tunnel der Friedrichsfelder U-Bahn einmündet.
Unter der Spree zeigten sich im Laufe der Jahre seit Kriegsende erhebliche Schäden am Tunnel, die zu beheben waren: Flusswasser ist zwischenzeitlich eingedrungen. Der Spreetunnel, der das Profil für zwei Gleise hatte, wurde in der Mitte durch eine Trennwand geteilt und mit einer zusätzlichen Innenverschalung versehen, die leichte konkave Wölbungen aufweist. Hierdurch wurde das Tunnelprofil auf das mindest-mögliche Maß verkleinert, aber der Tunnel war nun dicht. Eine Tunnelhälfte (die östliche) wurde der Länge nach verschlossen und blieb ohne Funktion, während die westliche Tunnelhälfte das Überführungsgleis aufnahm.
Ende wurde der
betriebsinterne Zugverkehr im Waisentunnel aufgenommen. Er
verband nun die GN-Bahn, die zwischenzeitlich die Bezeichnung
"Linie D" erhielt, und die Friedrichsfelder U-Bahnlinie
E.
Auch in späteren Jahren blieb die Geschichte dieses Tunnels
abwechslungsreich:
Um wurde im Waisentunnel, genauer: im Bereich des Bahnhofs
Stralauer Straße, eine Bunkeranlage eingefügt, die noch heute
existiert. Der Zugverkehr aber blieb trotz der Bunkereinbauten
weiterhin möglich.
wurde die BVG politisch bedingt zwischen beiden
Stadthälften aufgeteilt.
Die Linie D wurde, obwohl sie in diesem Bereich im Ostteil der
Stadt lag, vom westlichen Betriebsteil der BVG betrieben. Die
Linie E dagegen gehörte zur BVG-Ost.
Somit fanden seit diesem Zeitraum keine Umsetzfahrten im
Waisentunnel mehr statt. Er verlor zunehmend seine
Daseinsberechtigung. Diese Situation verschärfte sich noch, als
die Stadt durch die Mauer hermetisch getrennt wurde. Die
Linie D wurde zu einer Transitlinie, deren Züge im Osten nicht
hielten. Um die Bauwerke gegeneinander abzusichern wurde ein
Sperrtor in Höhe der Spreeunterfahrung eingebaut. Dieses Tor
sollte die Flucht von DDR-Bürgern durch diesen Tunnel
verhindern. Dennoch gelang einer Familie eines BVB-Angehörigen um die Flucht durch
den Waisentunnel in den Tunnel der Westlinie D: Ein Westberliner
U-Bahnzug nahm die Flüchtenden mit in den Westen.
Hin und wieder wurde dieses Tor
ganz offiziell geöffnet: erhielt die BVG-Ost vom
Westbetrieb ausrangierte U-Bahnwagen (Bauart A2) und noch einmal
wurden /89 U-Bahnwagen durch diesen Tunnel in den Osten
transportiert, diesmal "Stahldoras".
Seit dient dieser Tunnel wieder dem ganz normalen Aufgaben,
eine Gleisverbindung zwischen der U5 und U8 zu schaffen.
1952 bekam der Waisentunnel eine neue Bedeutung für die BVG-Ost: Er verband die Linie E mit dem neuen "Klostertunnel".
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Dieser Tunnel entstand auf
Veranlassung der BVG-Ost und wurde angelegt. Er verbindet
die Linie A am Bahnhof Klosterstraße (heutige U2) mit dem
Waisentunnel. Der Bau dieses Tunnels hatte politisch-historische
Gründe: Als die BVG geteilt wurde, verfügte die BVG-Ost
über keine Betriebswerkstatt für die Kleinprofilfahrzeuge auf
der damaligen Linie A. Somit mussten die Wagen dieser Linie beim
"Klassenfeind" im Westen gewartet werden. Das war für
die auf Unabhängigkeit bedachte BVG-Ost damals natürlich ein
Unding.
An der Linie E, der heutigen U5, dagegen befand sich eine große
Werkstatt, die nicht ausgelastet war. Es schien also sinnvoll,
beide Linien miteinander zu verbinden. Am 16. Februar wurde
der Tunnel fertig. Er beschreibt eine enge S-Kurve und wurde
unter einem damals unbebauten Trümmergrundstück errichtet.
Hierzu wurde eine Baugrube ausgehoben, in der ein flaches
Betonfundament errichtet wurde. Auf dieses Fundament errichtete
man Betonfertigteile, die zusammengesetzt einen nach oben sich elliptisch verjüngenden Tunnel darstellen.
Da dieser Tunnel die beiden Profilsysteme der Berliner U-Bahn verbindet, kann er keinem Profilnetz zugeordnet werden und weist einen Stromschienen-losen Gleisabschnitt auf. Hier konnten von den Kleinprofilwagen die Stromabnehmer abmontiert werden, eh die Wagen mittels so genannter "Stromwagen" über die Großprofilstrecke zur Wartung nach Friedrichsfelde gezogen werden konnten.
1993 wurde das Berliner U-Bahnnetz wieder vereinigt. Seither ist es nicht mehr erforderlich, Kleinprofilwagen in Friedrichsfelde zu warten. Seither dient der Klostertunnel nur noch für wenige Arbeitszug-Fahrten.
Um Abstellkapazitäten zu haben, wurde nördlich des U-Bahnhofs Pankow ein relativ kurzer Abstelltunnel mit erstellt. Er dient zum Abstellen und Kehren von U-Bahnzügen der Linie U2. Dieser Tunnel muss alltäglich genutzt werden, da es vor dem Bahnhof Pankow keine Gleisverbindungen gibt und somit ein Kehren am Bahnsteig nicht möglich ist. Der Abstelltunnel Pankow entstand im Zusammenhang mit dem Bau dieser Strecke um -.
Dieser Tunnel entstand zwischen und . Er ging im Mai in Betrieb als normaler Linientunnel, an dessen Ende sich der Bahnhof Richard-Wagner-Platz (bis : Wilhelmplatz) befand. Anfänglich fuhren dort die Züge aus Richtung Spittelmarkt/Nordring hin. Nach war es die Linie A I. waren es nur noch die Verstärkerzüge, die nach Pankow durchfuhren, während Züge zwischengeschaltet wurden, die nur zwischen Deutscher Oper und Richard-Wagner-Platz fuhren. Ab fuhr dort die Linie A III, sie pendelte nur noch zwischen Deutscher Oper und Richard-Wagner-Platz. wurde diese Linie umbenannt in "Linie 5". Am 2. Mai wurde der Linienverkehr eingestellt, der Tunnel war daraufhin ohne jede Funktion. Im Jahre wurde der Bahnhof Richard-Wagner-Platz abgerissen und an der selben Stelle der neue Großprofil-Bahnhof erstellt. Er ging im April für die Linie 7 in Betrieb. Um diesen Tunnel weiter nutzen zu können, entstand ein Ergänzungstunnel entlang des U7-Bahnhofs mit einer anschließenden Einfädelstelle zur U7. Auf diese Weise entstand das erste Kleinprofil/Großprofil-Verbindungsgleis in diesem Tunnel für den Westteil der Stadt. Er wurde daraufhin wertvoll für den Arbeitszugverkehr zwischen beiden Tunnelprofilen in West-Berlin.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Streckenbeschreibung:
Der Tunnel beginnt am U-Bhf. Deutsche Oper mit den beiden
mittleren Gleisen. Zunächst führt der Tunnel Richtung Westen
mit einer Steigung. Es folgt eine enge Rechtskurve aus der
Bismarckstraße heraus, wobei das U2-Richtungsgleis Richtung
Ruhleben überquert wird. Danach folgt die Strecke Richtung Norden
der Richard-Wagner-Straße. Unmittelbar vor dem
Richard-Wagner-Platz endet der Altbautunnel. An jener Stelle begann
einst der gebaute Bahnhof Richard-Wagner-Platz. Dieses Tunnelbauwerk stammt
bis zu dieser Stelle ebenfalls aus der Zeit von . Bis wurde dieser
Tunnelabschnitt regelmäßig von Zügen der Linie 5 befahren, die zwischen dem
Bahnhof Deutsche Oper und Richard-Wagner-Platz pendelte. Bis fuhren die
Züge grundsätzlich von hier nach Pankow (Vinetastraße).
Der alte Bahnhof Richard-Wagner-Platz (Bis : Wilhelmplatz) war dreigleisig und war zwischen und ohne Funktion, wurde damals abgerissen. Der weiterführende Streckentunnel fügt sich an den Altbautunnel an und verläuft unmittelbar östlich neben dem eröffneten Neubaubahnhof entlang. Hinter dem neuen Bahnhof Richard-Wagner-Platz mündet dieser Tunnel in den Streckentunnel der U7 ein, wobei sich vor der Einfädelung des Gleises eine Schutzweiche befindet.
Diese Tunnelanlage bot ab erstmalig für die BVG-West die Möglichkeit, Arbeitszüge zwischen beiden Profilnetzen auszutauschen und wurde daher nur relativ selten genutzt. Eine weitere Aufgabe dieses Tunnels besteht darin, dass er recht oft für Filmaufnahmen genutzt wird. Die Tunnelszenen des SAT-1-Films der Serie "Rosa Roth" (Reise nach nirgendwo) sind fast alle im Richard-Wagner-Tunnel gedreht worden.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Zwischen und baute die Hochbahngesellschaft mit Unterbrechungen die Entlastungslinie zwischen Gleisdreieck (oberer Bahnsteig) und Wittenbergplatz. In diesem Zusammenhang entstand am Nollendorfplatz der heutige U-Bahnhof mit seinen beiden übereinander liegenden Tunnelbahnsteigen. Gleichzeitig im Zusammenhang mit dem Bau dieser Linie erhielt die bislang unabhängige Schöneberger U-Bahn eine streckenmäßige Gleisanbindung an das übrige U-Bahnnetz. Dies war sowohl seinerzeit von der Stadt Schöneberg gewollt als auch von der Hochbahngesellschaft, die die Schöneberger U-Bahn ab betrieben hat. Seitens der Stadt Schöneberg wurde dieser Streckenanschluss bereits beim Bau der Strecke in der Form vorbereitet, als dass bereits eine Gleisrampe im damaligen Endbahnhof Nollendorfplatz (der Schöneberger U-Bahn) mit vorbereitet wurde, bis etwa aber mit Sand verfüllt blieb.
Die Sandrampe
Um -17 wurde an diesen Tunnelstutzen der neue Tunnelbereich mit dem heutigen U-Bahnhof Nollendorfplatz angefügt. Im oberen Tunnelbahnsteig halten die Züge kommend von Wittenbergplatz und Innsbrucker Platz, unten dagegen verläuft die Gegenrichtung.
Nördlich der beiden Tunnelbahnsteige befindet sich ein Überwerfungsbauwerk, wobei die Gleisebenen dahingehend verschoben werden, dass sich in der unteren Ebene die beiden Gleise Richtung Kurfürstenstraße befinden. In der oberen Ebene befand sich ursprünglich ein Tunnelabschluss. Laut damaliger Grundkarten befand sich das Tunnelende bereits innerhalb der Gentiner Straße, etwa 20 Meter hinter der Straßenkreuzung mit der Kurfürstenstraße.
Auch dieser Tunnelabzweig war bereits vor dem WK I vorgesehen: Die Stadt Schöneberg wollte, ursprünglichen Plänen zufolge, die Strecke zunächst durch das Tiergartenviertel weiterführen und letztendlich in der Innenstadt enden lassen. Von diesen Plänen war vordringlich in den 20er Jahren keine Rede mehr, aber einen Anschluss des Tiergartenviertels hielt man durchaus noch für denkbar. Auf alle Fälle baute man den gesamten Bahnhofs- und Tunnelbereich so aus, wie dies bereits vor dem WK I geplant war. Gleise aber wurden nur soweit verlegt, wie dies damals betrieblich notwendig erschien. So war das östliche Gleisbett im unteren Bahnsteig zum Beispiel viele Jahrzehnte nicht belegt.
In Berlins Südwesten gibt es ebenfalls einen kurzen U-Bahntunnel. Er befindet sich unter der Argentinischen Allee, beginnt direkt unter dem Bahnhofsgebäude. Er dient nur zum Abstellen von U-Bahnzügen. Die beiden Kehrgleise sind 107 Meter lang und bieten somit Platz für je einen 8-Wagenzug. Die normalen fahrplanmäßigen Züge nutzen diesen Tunnel nicht.
Auch unter dem Kurfürstendamm gab es
umfangreiche Kehrgleisanlagen:
Hinter dem Bahnhof Uhlandstraße befinden sich vier Kehrgleise mit einer Länge
zwischen 80 und 119 Metern, ausreichend für 7 bis 9 Wagen. Zusätzlich gab es
früher noch ein weiteres Kehrgleis vor dem Bahnhof, was heute noch an der
großen Tunnelbreite erkennbar ist: Dort konnten zusätzlich 6 Wagen auf einem
78 Meter langen Kehrgleis untergebracht werden.
Abstelltunnel
Tegel 
Hinter dem U-Bahnhof Alt-Tegel gibt es vier Kehrgleise zum Wenden der Züge.
Diese Anlage muss genutzt werden, da es vor dem Bahnhof keine Gleiswechsel gibt.
Abstelltunnel
Mariendorf 
Auch hinter diesem Bahnhof gibt es eine Kehrgleisanlage. Die aber muss und wird
in aller Regel von den Fahrgastzügen nicht genutzt.
Hierbei handelt es sich um einen betriebsinternen Tunnel, der auch "G-H-Tunnel" genannt wird: In den Bauunterlagen laufen diese beiden berührten Linien noch heute unter den Bezeichnungen "Linie G" und "Linie H".
Südlich des Bahnhofs Güntzelstraße fädelt sich ein Gleis aus, das zwischen den beiden Hauptgleisen der U9 befindlich ist. Es senkt sich im weiteren Streckenverlauf Richtung Süden ab und zweigt nach Westen ab. Hierbei wird das Richtungsgleis der U9 nach Steglitz unterquert und anschließend die nordwestliche Ecke der Platzkreuzung. Danach mündet dieses Gleis in das Richtungsgleis Spandau der U7 ein. Dies geschieht westlich des Bahnhofs Berliner Straße (unten). Hier finden nur relativ selten Umsetzfahrten statt, da von beiden Linien keine Fahrten zur Erreichung der Betriebswerkstätten durch diesen Tunnel erforderlich sind. (U9: BW Seestraße, U7: BW Britz)
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Der Tunnel entstand in den Jahren -70 zusammen mit dem gesamten Bahnhofsbauwerk Berliner Straße sowie mit dem "Wilmersdorfer Tunnel" im Zuge der Bundesallee. Im Januar ging der Bahnhof in Betrieb zusammen mit den Streckenverlängerungen der Linie 7 und 9, die am gleichen Tag eröffnet wurden.
KARSTADT-Tunnel


1926 wurden in Neukölln zwei U-Bahnstrecken gebaut: Der Neuköllner Abzweig der Nord-Süd-Bahn sowie die GN-Bahn. Nachdem die GN-Bahn als städtisches Projekt von der AEG übernommen wurde, war es naheliegend, beide Linien durch einen internen Tunnel zu verbinden. Dies bot sich am Hermannplatz an, da sich hier beide Linien kreuzen. Der Hermannplatz selbst aber war damals nur eine breite Verbindungsstraße zwischen der Hasenheide und Urbanstraße. Die Nord-Süd-Bahn-AG erwarb die Grundstücke auf der Westseite des Platzes, um den nötigen Platz zum Bau des U-Bahnhofes zu erhalten. Nach dem Bau der U-Bahn sollte der Platz wesentlich vergrößert und der Rest des Grundstücks weiter veräußert werden.
Der Hamburger Warenhauskonzern Rudolf Karstadt suchte in Berlin einen exponierten Ort, wo ein großes Warenhaus erstellt werden könnte. Hierzu eignete sich dieses Grundstück am (vergrößerten) Hermannplatz hervorragend. Der Konzern kaufte das 12500 qm große Grundstück und errichtete dort das größte Warenhaus Europas. Gleichzeitig wurde der sogenannte Karstadttunnel errichtet. Der Karstadttunnel wurde im Sommer in Betrieb genommen, während das Warenhaus über dem Tunnel errichtet und am 21. Juni eröffnet wurde.
Der Begriff
"Buschmann-Tunnel" wurde von Zugfahrern geprägt.
Einst gab es einen Zugfahrer namens Buschmann, der es zweimal fertig brachte,
das am Ende des Karstadttunnels befindliche Schutzsignal Sh 2 Richtung Südstern
zu überfahren, so geht die Legende. Seither hatte der Tunnel seinen Namen weg.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen
Neukölln hatte
seine Attraktion. Die Ausmaße des Warenhauses waren schlichtweg
gigantisch.
Näheres zur Geschichte dieses Hauses
Für die U-Bahn war der Karstadttunnel von wichtiger Bedeutung. Er war die einzige Verbindung zwischen der heutigen Linie 6 und 7 hinüber zu den Linien 5 und 8.
Noch heute fahren regelmäßig Züge durch diesen Tunnel: Die Züge der Linie 8 werden von der BW Britz betreut, und müssen, um diese Werkstatt zu erreichen, durch den Karstadttunnel zur U7 fahren.
Tunnelbeschreibung:
Nördlich des Bahnhofs Hermannplatz (oben) befinden sich
Kehrgleisanlagen. Unter der Platzkreuzung Kottbusser
Damm/Urbanstraße spaltet sich der eingleisige Tunnel ab und
weist ein Gefälle auf. Unterhalb des Warenhausgebäudes
beschreibt der Tunnel eine Kurve und mündet schließlich
westlich des Bahnhofs Hermannplatz (unten) in den
U7-Streckentunnel mit den dortigen Kehranlagen ein.
Zum Bahnhof Hermannplatz gibt es noch eine Merkwürdigkeit anzumerken: Sie betrifft die Kehrgleisanlage auf der U7 östlich des Bahnhofes: Diese zweigleisige Kehranlage liegt zum Teil in einem tiefen Trog zwischen den beiden Hauptgleisen. Es hat den Anschein, als wenn sich am Ende dieser Kehrgleise ein weiterer Tunnel für eine abzweigende Linie anschließen sollte. Dies war niemals vorgesehen. Der Gleisbereich verschwindet nur deshalb in einem Trog, weil es unbedingte Voraussetzung ist, dass Kehrgleise völlig waagerecht liegen und keine Steigungen oder Gefälle haben dürfen. Die Hauptgleise Richtung Rathaus Neukölln bzw. Rudow steigen in diesem Bereich an, da der Bahnhof Hermannplatz eine außergewöhnlich große Tiefe aufweist, die Strecke im weiteren Verlauf aber preisgünstig im Bau direkt unter der Straße weiter verlaufen sollte.
Dieser Tunnel entstand am südlichen Ende der damaligen Linie D im Jahre und war anfänglich ein toter Tunnel ohne jede Aufgabe für die BVG. Er reichte vom Bahnhofsende Leinestraße bis unmittelbar vor die Ringbahn am S-Bahnhof Hermannstraße. Dort war sogar schon ein Drittel des U-Bahnhofs Hermannstraße inklusive aller Zugangsbauwerke im Rohbau erstellt. Um wurde dieses Bahnhofsfragment zu einem öffentlichen Luftschutzraum umgestaltet. Doch für die U-Bahn hatte das ganze Bauwerk damals noch keine Bedeutung. Dies änderte sich . Damals wurden in diesem Tunnel zwei Gleise verlegt, die im Anschluss an den Bahnhof Leinestraße bis fast zum Bauwerksende im Bahnhofsfragment Hermannstraße reichen. Diese Gleise, die über keinerlei Weichen verfügten und sich direkt an den Bahnsteiggleisen in Leinestaße anschlossen, hatten nur eine Aufgabe: Auf ihnen wurden in der Folgezeit ausgemusterte B- und C-Wagen abgestellt. Sie sollten anfänglich ale eine Betriebsreserve behalten werden, doch diese Aufgabe erledigte sich im Laufe der Jahre. Erst als beschlossen wurde, diese U-Bahnstrecke bis zum Bahnhof Hermannstraße fertig zu stellen, wurden die abgestellten U-Bahnwagen entfernt. Heute ist dieser Tunnel ein ganz normaler U-Bahntunnel.
Hinter dem vervollständigten und neuen U-Bahnhof Hermannstraße befindet sich eine viergleisige Abstellanlage. Sie ist so bemessen, dass maximal vier 6-Wagenzüge abgestellt werden können.
Diese beiden Tunnel
entstanden für den dienstinternen Verkehr.
Der Leopoldtunnel (C-G-Tunnel) entstand zwischen und .
Er verbindet den Bahnhof Seestraße mit der Kehrgleisanlage des
Bahnhofs Leopoldplatz (unten), also die U6 mit der U9. Bis
war dieser Tunnel der einzige, der die Linie 9 mit dem übrigen
U-Bahnnetz verband.
Der Tunnel beginnt südostlich des Bahnhofs Seestraße und führt in einer steilen scharfen Kurve unter dem Leopoldplatz hindurch und mündet von Westen in die Linie 9 ein. Allerdings sind von hier aus nur die Kehrgleise am Leoplodplatz erreichbar. Eine direkte Weiterfahrt Richtung Osloer Straße ist nicht möglich.
Zwischen und entstand wenig weiter nord-östlich ein weiterer interner Tunnel, der Osloer Tunnel (G-D-Tunnel). Er verbindet die U9 mit der U8.
Hinter dem Bahnhof Nauener Platz (U9) beginnt ein in der Mitte zwischen den Hauptgleisen gelegenes internes Gleis, der Streckentunnel zwischen Nauener Platz und Osloer Straße ist demzufolge dreigleisig. Wenig weiter nördlich (unter der Kreuzung Exerzier- und Heinz-Galinski-Straße senkt sich dieses Gleis ab und verschwindet in einem eigenen Tunnel. Darüber beginnt ein weiteres Kehrgleis, es gehört zum Bahnhof Osloer Straße. der Osloer Tunnel dagegen zweigt nach Norden ab und mündet unter der Schwedenstraße in die Kehrgleisanlage der U8 ein. Ähnlich wie am Leopoldtunnel ist auch hier eine direkte Weiterfahrt Richtung Norden (nach Wittenau) nicht möglich.
Plan aus rechtlichen Gründen offline genommen






