Berliner U-Bahn-Lexikon
Teil 2: L - Z
L
La
Schriftliche Aufzeichnung aller
Langsamfahrstellen im Netz der Berliner U-Bahn. Erscheint für das Fahrpersonal
in Neuauflagen je nach Bedarf.
LDU
Lagedienst U-Bahn
Leitstelle für den gesamten Betriebsablauf bei der U-Bahn.
Früher "VUM" genannt.
Leitgebel, Wilhelm ( - ?)
Städtischer Beamter in Wilmersdorf
Entwarf zwischen und sämtliche Bahnhöfe der Wilmersdorfer U-Bahn,
(U1, von Hohenzollernplatz bis einschließlich Breitenbachplatz) sowie auf
Wunsch und Kosten der Stadt Wilmersdorf einen Zugang des Bahnhofs Nürnberger
Platz.
Leopoldtunnel
Siehe C-G-Tunnel
LEW
VEB Lokomotivbau und Elektrotechnische Werke Hans Beimler Hennigsdorf
LEW baute für die Ost-Berliner U-Bahn vor allem die Züge der Bauarten G.
LEW war vor dem 2. WK ein Produktionsstandort der AEG, wurde dies auch nach der
Wende wieder, bevor die AEG von Daimer-Crysler übernommen wurde und daraus der
Transporttechnikkonzern "Adtranz" wurde.
Lindentunnel
eröffneter, von der GBS gebauter Straßenbahntunnel zur Unterquerung der
"Linden". außer Betrieb genommen. Ursprünglich war der Tunnel
viergleisig, wobei sich beide Gleisgruppen in südlicher Richtung in zwei Einzeläste
aufteilten. Der Ostzweig wurde bereits außer Betrieb genommen.
Linke und Hofmann
Dieses in Breslau ansässige Unternehmen baute für die Hochbahngesellschaft und
die BVG zwischen und vorwiegend Großprofilzüge.
Linienbezeichnungen
L. in der heutigen Form sind seit März üblich. Damals wurden für die
existierenden neun Linien West-Berlins numerische Linienbezeichnungen eingeführt.
wurden sie bundeseinheitlich durch ein "U" ergänzt, was aber in
erster Linie mit der damaligen S-Bahnübernahme zu tun hatte. Seit
bestanden bereits Lücken für die Ostberliner Linien, falls es zu einer
Vereinigung der Verkehrsnetze kommen sollte. Dieser Planung entsprechend wurden
die Ostberliner Strecken im Juli eingegliedert.
Zwischen und gab es
Linienbezeichnungen bestehend aus Buchstaben zuzüglich römischer Ziffern.
Eine Buchstabenlinie war die Hauptstrecke, römisch dagegen wurden die
Zweigstrecken bezeichnet. Ab aber verschwamm dieses ursprünglich klare
System, da sich die Fahrgastströme verändert haben. Dies bewog die BVG-West
dazu, dieses Bezeichnungssystem -zumindest in der Öffentlichkeit-
aufzugeben. Intern behielten die Bezeichnungen aber ihre Funktion.
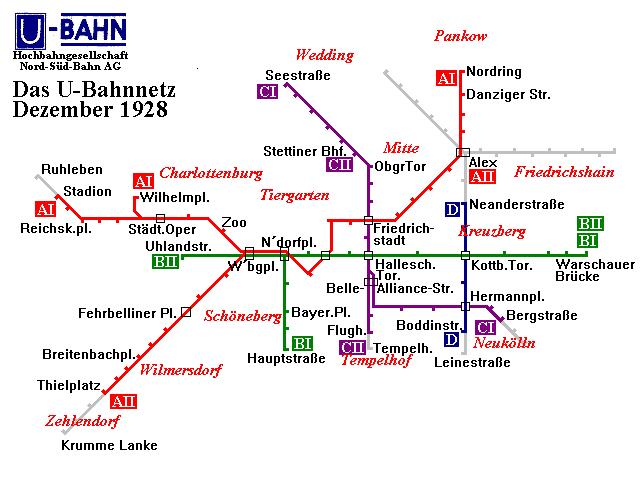
LISI
Integriertes Leit-,
Informations-
und SIcherungssystem
LISI ist das EDV-gestützte Leitsystem der U-Bahn mit den beiden
Hauptkomponenten Zuglaufüberwachung und Stellwerks-Fernsteuerung. Die
Zuglaufüberwachung ist mittlerweile für alle U-Bahnlinien realisiert, womit
jederzeit jeder Zug im Netz lokalisiert werden kann. Die
Stellwerks-Fernsteuerung ist zum Jahresende ebenfalls netzweit
funktionsfähig. Im Sommer fehlen nur noch die Linien U6 und U9. Somit ist
es möglich, den Zugbetrieb komplett von der Hauptverwaltung aus zu überwachen
und gegebenenfalls zu beeinflussen.
LZB 500
Von der Fa. Siemens entwickeltes Steuersystem für den vollautomatischen (und
theoretisch fahrerlosen) U-Bahnbetrieb. Wurde in Berlin ab erprobt und von
bis regelmäßig auf der U9 angewendet.
Die "Linien-Zug-Beeinflussung" erfolgte über Impulse durch ein im
Gleis verlegten Kabel als Antenne.
M
M-Bahn
Im Jahre wurde in Berlin eine
Magnetschwebebahn in Betrieb genommen. Sie fuhr zwischen dem U-Bahnhof
Gleisdreieck (unterer Bahnsteig) und der Landwehrkanalbrücke auf den alten
Hochbahnviadukten von . In dieser Zeit diente die Bahn nur
Erprobungszwecken. Ab wurde die Strecke Richtung Norden erweitert und auf
einer eigenen Pfeilerstrecke bis zum Kemperplatz erweitert. Die gesamte Strecke
war zweigleisig angelegt und erhielt die beiden zusätzlichen Haltepunkte "Bernburger
Straße" und "Kemperplatz".
Nach mehreren Zwischenfällen konnte der öffentliche Versuchsbetrieb (als "M-Bahn" bezeichnet) im Sommer aufgenommen werden. Mitte Juli erhielt die M-Bahn die offizielle Betriebsgenehmigung der Technischen Aufsichtsbehörde und wurde somit entgeltpflichtiges Regelangebot der BVG. Zuvor war die Benutzung kostenfrei. Am 1. August jedoch wurde dieses interessante Verkehrsmittel wieder stillgelegt und später demontiert, da die zum Teil genutzte Hochbahntrasse am Gleisdreieck für die Wiederinbetriebnahme der U2 benötigt wurde.
Über längere Zeit wurden die Gleisanlagen und Fahrzeuge für eine neuerliche Verwendung an anderem Ort zwischengelagert, doch hat sich der Berliner Senat zwischenzeitlich von diesen Plänen und somit vom Inventar getrennt. Es war eine zeitlang ernsthaft in Erwägung gezogen worden, das komplette West-Berliner Kleinprofil-U-Bahnnetz auf M-Bahntechnik umzustellen.
Mäusetunnel
Fußgängertunnel als Verbindungsweg
zwischen den beiden Bahnsteigen der U2 und U6 im U-Bhf. Stadtmitte.
Magistratsschirm
Umgangssprachlich ältere Bezeichnung für
einen Hochbahnviadukt unter dem man entlang spazieren kann.
Manometer
Ein Manometer ist ein Gerät zur Druckmessung. Auf dem Fahrerpult befindet sich
z. B. das Doppelmanometer. Es zeigt sowohl den Druck in der Füllleitung als
auch den Druck in der Bremssteuerleitung an.
Mariendorfer Strecke
eröffnete U6 von Tempelhof nach
Alt-Mariendorf
Marmor
Der Baustoff Marmor war in Berlin bei der Ausgestaltung von U-Bahnhöfen
normalerweise nie üblich. Eine Ausnahme bildet der U-Bhf Mohrenstraße: Dieser
im krieg völlig zerstörte U-Bahnhof erhielt bei seinem Wiederaufbau eine
Vollverkleidung mit verschiedenfarbigen Marmorplatten, die sämtlich aus der
abgerissenen benachbarten Reichskanzlei stammten. Der Bahnhof ging in dieser
Form mit dem Namen Thälmannplatz am 18. August wieder in Betrieb.
Mehrzweckbauten
Die beiden U-Bahnhöfe Pankstraße und Siemensdamm sind sogenannte
Mehrzweckbauten. Sie können im Krisenfall als öffentliche Schutzräume dienen.
Hierzu besitzen die Bahnhofsbauten entsprechende Ausrüstungen: Schutztore können
sämtliche Zugänge sowie auch die Streckentunnel gasdicht verschließen. Eine
Luftfilteranlage sowie ein Trinkwasser-Tiefbrunnen ergänzen die Ausstattung. In
Nebenräumen sind zusammensteckbare Feldbetten vorhanden. Die volle Leistungsfähigkeit
aber erreichen die Anlagen erst, wenn je zwei Sechswagenzüge im Bahnhofsbereich
abgestellt sind. Pankstraße, fertiggestellt, ist für 3.300 Personen
ausgelegt, Siemensdamm dagegen wurde fertig und fasst 4.500 Personen. Es
gehört allerdings in das Reich der Legenden, dass die Bauwerke einen
Atombombenangriff unbeschadet überstehen würden. Noch heute werden die
Schutztore in regelmäßigen Abständen auf ihre technische Gangbarkeit hin
untersucht.
Meldelampe
Das Aufleuchten einer Meldelampe signalisiert dem Zugfahrer eine Zustandsänderung
eines Gerätes am Zug. Wenn z. B. die rote Meldelampe "Automat"
aufleuchtet, ist mindestens ein Starkstromautomat des Zuges ausgeschaltet. In
welcher Einheit dies der Fall ist, erkennen Sie allerdings nur an der >
Kennlampe.
Metro
International üblicher Einheitsbegriff für eine Stadtschnellbahn im
Sinne einer U-Bahn. Nur im französisch-sprachigen und im osteuropäischen Raum
hat sich dieser Begriff auch im allgemeinen Sprachgut durchgesetzt. Der Begriff
"Metro" entstand um in Paris als Abkürzung für "Metropolitain
Chemin de Fer".
Siehe auch "preMetro"
Ministerfahrt
Am 15. Februar fand in Berlin die sogenannte Ministerfahrt statt. Auf
dieser Fahrt wurde den Ministern und öffentlichen Vertretern die neue Berliner
Hochbahn vorgeführt. Näheres: Siehe Bericht
im Berliner Lokalanzeiger
Mittelbahnsteig
Ein M. liegt stets zwischen den beiden
Hauptgleisen einer U-Bahnlinie. Man erreicht also von diesem Bahnsteig aus die
U-Bahnzüge in beide Fahrtrichtungen. Auch "Inselbahnsteig" genannt.
Ein U-Bahnhof mit M. ist zum Beispiel der U-Bahnhof Hansaplatz (U9). In Berlin
überwiegen Bahnhöfe mit Mittelbahnsteigen.
(siehe auch "Seitenbahnsteig")
Modellbahn
In der U-Bahn-Ausbildungsstätte an der Turmstraße gibt es eine H0-Nachbildung
der Linie U9. Allerdings besteht sie nur aus der Strecke Spichernstraße -
Schulstraße und entspricht somit dem Zustand von , wenn es auch den U-Bhf.
Schulstraße nie gab. An dieser Anlage können alle Arten von im U-Bahnalltag
vorkommenden Störungen simuliert werden. An ihr wurden ganze Generationen von
Zugabfertigern ausgebildet.
Möhring, Bruno ( -
) und Sohn Rudolf
Architekt Bruno entwarf u.a. die Schwebebahn-Haltestelle Döppersberg in
Wuppertal. Für die Berliner U-Bahn entwarf er den Hochbahnhof Bülowstraße.
Sein Sohn Rudolf verlängerte die Hallenkonstruktion.
Moskauer Züge
Im Spätsommer hatte die BVG 120 U-Bahnwagen als > Reparation an die
Moskauer Metro abzugeben. Hierbei handelte es sich um zwischen und
gebaute C-Wagen der 18-Meter-Bauart. Die Züge wurden den Moskauer Verhältnissen
angepasst und bis etwa dort eingesetzt. Die Züge eigneten sich gut für
den Einsatz in Moskau, da dort in den Abmessungen vergleichbare Züge eingesetzt
wurden. Das ist kein Zufall, denn die eröffnete Moskauer Metro hatte die
Berliner U-Bahn zum Vorbild. Die Abgabe der 120 U-Bahnwagen war nicht die
einzige Reparationszahlung seitens der BVG.
Motorwagen
Vollmotorisierter Triebwagen ohne Führerstände.
Diese Wagen durften stets nur in der Zugmitte eingesetzt werden und eigneten
sich vornehmlich in langen Zügen (6-8-Wagenzügen)
Zuggattungen: A-I, A-II
Motzstraßenbahnhof
Hierbei handelt es sich um den Bahnhof Nollendorfplatz der Schöneberger U-Bahn.
Dieser von Anfang an provisorische Bahnhof wurde eröffnet und im Oktober
durch den heutigen Bahnhof ersetzt und somit geschlossen.
Münchner U-Bahn
Nach Berlin und Hamburg erhielt München im Jahre die dritte U-Bahn
Deutschlands. Der Bau einer U-Bahn in München wurde bereits seit
diskutiert, aus wirtschaftlichen Gründen aber immer wieder verschoben. Erst
wurde nahe der Innenstadt ein Streckentunnel für ein S-Bahn-ähnliches
Verkehrsmittel begonnen, der aber wegen des ausgebrochenen Krieges nicht
vollendet wurde. In den 50er Jahren wurde der Bau einer U-Straßenbahn
angedacht, mit deren Bau begonnen werden sollte. Aufgrund
der enormen Verkehrsprobleme und der chronisch überlasteten Straßenbahn in der
Bayerischen Metropole entschied sich der Stadtrat im Jahre zum Bau einer
echten U-Bahn wie sie in Hamburg und Berlin existiert, mit deren Bau im Folgejahr begonnen wurde.
Zunächst war nur der Bau
einer Nord-Süd-Linie vorgesehen, doch erweiterte man den Bau, als München
die
Olympia-Zusage für erhielt. So konnte rechtzeitig vor Beginn der Olympiade
nach der ersten Linie eine zweite U-Bahnlinie, die "Olympia-Linie",
eröffnet werden. Seither wurde unablässig und mit atemberaubendem Tempo das
Streckennetz erweitert: Kaum ein Jahr verging, ohne dass nicht mindestens eine
neue U-Bahnstrecke fertig gestellt wurde.
Heute umfasst das Münchner U-Bahnnetz eine Streckenlänge von etwa 80 Kilometern mit sechs betriebenen Linien, die sternförmig das gesamte Stadtgebiet erschließen und in der Innenstadt auf drei Stammstrecken gebündelt sind und fast ausschließlich unterirdisch verlaufen. Die älteren Bahnhöfe wurden sehr schlicht und nach einheitlichen Plänen gestaltet und wirken dadurch sehr monoton. Bei den jüngeren Bahnhöfen dagegen wurden architektonisch sehr mutige Entwürfe ausgeführt, die unbedingt sehenswert sind. München leistet sich auf den neueren U-Bahnhöfen den Luxus, auf jede Art der kommerziellen Werbung in den Bahnsteighallen zu verzichten. Erwähnenswert ist, dass inzwischen fast alle U-Bahnhöfe über Aufzüge verfügen und somit behindertengerecht ausgebaut sind. Die Münchner U-Bahn wurde zum technischen und betrieblichen Vorbild für die fast zeitgleich entstandene Nürnberger U-Bahn, die im März eröffnet wurde. Es werden, von der Farbgebung abgesehen, fast baugleiche U-Bahnzüge eingesetzt.
Projekte:
Der eröffnete U-Bahnhof Marienplatz wird derzeit mit großen technischen
Aufwand umgebaut, da der Bahnhof den enormen Pendlerströmen schon lange nicht
mehr gewachsen war: Unter dem Rathaus werden hierzu gegenwärtig wesentlich
erweiterte Bahnsteighallen gebohrt.
Derzeit erfolgt der Bau von zwei Strecken: Die U6 wird im Auftrage der Stadt
Garching bis zur TU erweitert. Fertigstellung soll sein. Im Westen wird die
U3 ab Olympia-Zentrum bis zum Georg-Brauchle-Ring erweitert. Eröffnung ist
. Später ist eine Weiterführung bis nach Moosach vorgesehen, die
fertig sein soll. Langfristig ist der Bau einer Strecke nach Englschalking (U4),
nach Pasing (U6) und nach Martinsried (U6), einem Vorort, vorgesehen. Dann wird
das Netz rund 110 Kilometer lang sein und somit Hamburg in der Streckenlänge
knapp überrundet haben. München hat dann das zweit-größte U-Bahnnetz
Deutschlands! Diese Strecken sind zum Teil umstritten, da jene Stadtgebiete von
der Straßenbahn erschlossen sind oder werden können. Die Martinsried-Strecke
wird von jener Gemeinde finanziert. Aufgrund des bereits vorbildlichen und sehr
ausgedehnten Streckennetzes sind einige weitere Planungen zunächst zu den Akten
gelegt worden, wie z. B. der Bau der Geiselgasteig-Strecke ab Mangfallplatz.
Mutter-Uhr
Alle Uhren in den Anlagen der Berliner U-Bahn werden von einer zentralen
Mutter-Uhr gesteuert. Hiermit wird erreicht, dass alle Uhren den absolut
gleichen Gang haben. Die Mutter-Uhr steht in der Uhrenzentrale in der
Hauptverwaltung.
Mutz-Keramik
Keramische Werkstätten Richard Mutz & Rother in Liegnitz (heute: Legnica,
Polen)
Charakteristisch für "Mutz-Keramik" ist die ungleichmäßige Farb-
und Oberflächenbeschaffenheit der einzelnen verwendeten Fliesen. Mutz-Keramik
ist auf den alten Wilmersdorfer Bahnhöfen (U1: v.a. Fehrbelliner Platz) und Schöneberger
Bahnhöfen (dort v.a. Bayerischer Platz) verbreitet und noch heute anzutreffen.
N
Nachtverkehr
Auf den Linien U12 und U9 findet seit
in den Wochenendnächten ein regelmäßiger U-Bahnnachtverkehr statt. Bereits in
den 50er Jahren gab es im Ostteil der Stadt einen U-Bahnnachtverkehr. Seit Juni
wird auf fast allen U-Bahnlinien in den Wochenend-Nächten ein
durchgehender Nachtverkehr im Viertelstundentakt geboten.
Neuköllner Zweig
Zweigstrecke der Nord-Süd-Bahn, zwischen
Mehringdamm und Grenzallee, eröffnet zwischen und 30.
Heute Bestandteil der Linie U7.
Neuzeit-Grotesk
Bei der BVG-West in den 50ern und frühen 60ern übliche Schrifttype. Wurde in
vielen Publikationen und Netzspinnen verwendet. Diese Schrift tauchte erstmals
in den 20ern auf den Bahnhofschildern der heutigen U8 auf. Leider ist diese schöne
klare Schrift etwas aus der Mode gekommen.
Schrifttype "Neuzeit-Grotesk"
Netzspinne
Graphische und meist farbige Darstellung des U-Bahnnetzes in den Fahrzeugen und
auf Bahnhöfen, bzw. Publikationen. Die erste Netzspinne im heutigen Sinne
tauchte für die Berliner U-Bahn in den ausgehenden 20er Jahren auf. Der lineare
Netzplan, dessen Vorbild ein elektrischer Schaltplan war, wurde erstmalig für
die Londoner U-Bahn in den 20er Jahren entworfen, setzte sich für ähnliche
Schnellbahnnetze in kurzer Zeit weltweit durch.
Der Begriff "Netzspinne" wurde vom Berliner Volksmund anfänglich für
den spinnenartigen S-Bahnnetzplan geprägt.
niveaufreie Verzweigung
Streckenkonstruktion, an der sich zwei Strecken in verschiedenen Ebenen mittels
Rampen verzweigen. Es ist die übliche Verzweigungsform bei der Berliner U-Bahn.
Beispiel hierfür ist die Streckenverzweigung der U6 und U7 nördlich und südlich
des Bahnhofs Mehringdamm.
niveaugleiche Verzweigung
Streckenkonstruktion, an der sich zwei Strecken über Gleiskreuzungen in
gleicher Ebene verzweigen. Dies ist bei der Straßenbahn üblich. Bei der
Berliner U-Bahn sind solche Verzweigungen nie gebaut worden. Die einzige
deutsche "U-Bahn", die solche Verzweigungen kennt, ist die Stadtbahn
in Köln. (z. B. Appelhoffplatz)
Nockenschaltwerk
Einrichtung zur Steuerung der Fahrgeschwindigkeit eines U-Bahnzuges. Der
Fahrstrom wird mit Hilfe einer Schaltwalze und zugehörigen Schaltnocken im
Verlauf des Anfahrens über eine zunehmend kleinere Anzahl von Widerständen den
Fahrmotoren zugeführt. In den Widerständen wird der überschüssige Strom
vernichtet bzw. zur Heizung des Fahrgast-Innenraumes genutzt. Diese Steuerung
war bei den bis gebauten U-Bahnzügen üblich.
Nord-Süd-Bahn
Erste Großprofil-Linie der Berliner U-Bahn.
Eröffnet im Januar zwischen Halleschem Tor und Zinnowitzer Straße. Im
engeren Sinne zählt der U6-Abschnitt Mehringdamm - Seestraße zur Nord-Süd-Bahn.
(Nicht zu verwechseln mit der Nord-Süd-S-Bahn oder bahnamtlich "Nordsüdbahn")
Nordsüdbahn-AG
Am 2. Mai gegründetes städtisches
Unternehmen, sollte eigentlich den U-Bahnbetrieb auf der heutigen U6 führen,
war faktisch aber nur für den Bau neuer Strecken verantwortlich. Gehörte ab
zur BVG und wurde am 1. April aufgelöst.
Nordsüdbahnform
Vor dem Zweiten Weltkrieg übliche Bezeichnung für das Großprofil im
Allgemeinen, speziell auch für die Fahrzeuge des Großprofils, wobei es hier
noch eine nachfolgend genannte Unterscheidung gab. Im Ggs. zur > Hochbahnform
Nordsüdbahnform I
Bezeichnung für die ab beschafften 13 Meter langen Großprofilzüge der
Bauart B. Diese Bezeichnung war ab etwa üblich.
Nordsüdbahnform II
Bezeichnung für die ab beschafften 18 Meter langen Großprofil-Probezüge
der späteren Bauart C.
Nordringlinie
U-Bahn- und Hochbahnstrecke zwischen
Alexanderplatz und Schönhauser Allee, eröffnet im Juli .
Notausstieg
Notausstiege dienen zum direkten Verlassen des Tunnels in besonderen Gefahrfällen,
wenn keine andere Möglichkeit der Bergung besteht. Zwischen zwei Bahnhöfen
befindet sich in aller Regel ein Notausstieg. Notausstiege sind durch Schilder
kenntlich gemacht, bzw. bei eingeschaltetem Tunnellicht an den blauen Lichtern
erkennbar.
Nürnberger U-Bahn
Nach Berlin, Hamburg und München erhielt Nürnberg die vierte U-Bahn
Deutschlands, die im Jahre den Betrieb aufnahm. Lange wurde in Nürnberg
der Bau einer U-Straßenbahn diskutiert, doch wegen der hohen zu erwartenden
Pendlerströme zwischen der Innenstadt und dem südöstlich gelegenen
Neubaustadtteil Langwasser entschied sich die Stadtverwaltung für den Bau einer
"echten" U-Bahn. Hierbei nutzte man die Erfahrungen beim Münchner
U-Bahnbau und lehnte die Nürnberger U-Bahn technisch weitestgehend an die
Münchner U-Bahn an. Dies zeigt sich u. a. an den so gut wie baugleichen
U-Bahnzügen. Es war sogar möglich mit München eine Art
"Fahrzeugunion" zu bilden: Nürnberger Züge liefen zur Olympiade
auf dem Münchner Streckennetz, und umgekehrt liefen Münchner Züge auch schon
mal in Nürnberg. Hierbei war sogar ein elektrischer Zusammenlauf aus gemischten
Zügen möglich. Die dunkelroten Nürnberger Züge (in München
blau/weiß) verfügen über einen Hilfsstromabnehmer auf dem Dach für
Werkstattfahrten, den die Münchner Wagen nicht haben. Der einzige wirkliche
Unterschied zur Münchener U-Bahn sind die rund
ein Drittel kürzeren Bahnsteige in Nürnberg: Während in München daher
6-Wagenzüge möglich sind, können min Nürnberg nur 4-Wagenzüge eingesetzt
werden.
Als erstes wurde die Linie U1 von Langwasser in Abschnitten in die Innenstadt
eröffnet, danach in mehreren Abschnitten nach Nordwesten in die Vorstadt
Fürth. Anschließend wurde die U2 von Südwesten durch die Innenstadt nach
Nordosten gebaut, die schließlich bis zum Nürnberger Flughafen reicht.
Projekte:
Schlagzeilen in der Fachpresse macht Nürnberg gerade mit dem Bau einer dritten
U-Bahnlinie, die -erstmalig in Deutschland- vollautomatisch verkehren wird. Die
U3 soll eröffnet werden. Sie wird später an beiden Enden noch
verlängert. Da die U3 Streckenteile der U2 mitbenutzen wird, ist mittelfristig
daran gedacht, auch die U2 auf vollautomatischen Betrieb umzustellen. Hierzu ist
die Beschaffung eines neuen Wagenparks im Gange. Eine Umstellung der U1 auf
automatischen Betrieb ist erst dann aktuell, wenn der alte Wagenpark durch
Neubauten ersetzt wird, also frühestens in etwa 30 Jahren. Derzeit sind
Streckenerweiterungen bei der U2 nicht vorgesehen. Die Stadt Fürth hingegen, wo
die U1 endet, wird die Strecke auf eigene Kosten noch erweitern: Sie soll in
zwei Abschnitten fertig gestellt werden. Danach ist der Endausbau der
Nürnberger U-Bahn erreicht. Weitere Planungen, die es durchaus gab, sind nicht
mehr aktuell, da Nürnberg die bestehende Straßenbahn behalten wird und hiermit
die für eine U-Bahn ursprünglich vorgesehenen Stadtteile erreicht
NVZ
Nebenverkehrszeit
Betriebszeit während des Tages außerhalb des Berufsverkehrs. Gemeint ist die
Zeit von etwa 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie ab 19.00 Uhr.
O
Ölkanne
BVG-umgangssprachlich für den Schmierzug.
Dieser Zug wurde telefonisch von Bahnhof zu Bahnhof durchgemeldet: "Pass
auf, um soundso viel Uhr kommt die Ölkanne" Heute finden diese Meldungen
nur noch von Stellwerk zu Stellwerk statt. Die aber sagen nicht Ölkanne!
(D-Einheit /) Siehe Schmierzug-Bericht
Östliche Stammstrecke
Erste U-Bahnstrecke Berlins. Wurde im
Februar zwischen der Oberbaumbrücke und dem heutigen Gleisdreieck eröffnet.
(Stralauer Tor - Potsdamer Platz)
Offene Bauweise
In Berlin üblicherweise praktizierte
Bauweise von U-Bahntunneln, wobei eine Baugrube ausgehoben wird, in dem anschließend
der U-Bahntunnel entsteht. In Berlin wurde diese Bauweise im Laufe der
Jahrzehnte spezialisiert und an die geologischen Gegebenheiten angepasst, so
dass man von der "Berliner Bauweise" spricht, die sich zum Beispiel
von der "Hamburger Bauweise" unterscheidet.
Orientexpress
Umgangssprachliche Bezeichnung aus den 70ern
und 80ern für den Ostteil der Linie 1 durch Kreuzberg, wo es einen relativ
hohen türkischen Ausländeranteil gab.
Osloer Tunnel
D-G-Tunnel, befindet sich zwischen den
U-Bahnhöfen Nauener Platz und Franz-Neumann-Platz und verbindet am U-Bahnhof
Osloer Straße die Linien U8 und U9 miteinander.
Ost-Dora
Bezeichnung für die /89 an die BVG-Ost abgegebenen Züge der Bauart
D.
(ex D 57 und D 60)
P
Pankower U-Bahn
Im engeren Sinne die Strecke der U2 nördlich
des Bahnhofs Schönhauser Allee, im weiteren Sinne die U2 ab Alexanderplatz
Pastorenkurve
Streckenabschnitt der Hochbahn an der Bülowstraße,
wobei die Bahn einen Bogen um die Lutherkirche macht.
Pendelbetrieb
Betriebsform im Ausnahmefall im Bereich von
Baustellen. (War auch nach dem WK II über längere Zeit üblich.
Ein Zug pendelt zwischen bestimmten Bahnhöfen auf einem Gleis hin und her. Im
Gegensatz zum Umlaufbetrieb.
Perlschnur
Graphisch farbig dargestellter Verlauf einer oder mehrerer U-Bahnlinien mit sämtlichen
Bahnhöfen und Umsteigebeziehungen. Perlschnüre sind in den U-Bahnzügen über
den Fahrgasttüren richtungskorrekt angebracht. Richtungskorrekt bedeutet, dass
z. B. das südliche Ende einer U-Bahnlinie tatsächlich Richtung Süden zeigt.
Polarität
Die U-Bahn benötigt zum Betrieb 750 Volt Gleichstrom. Der Stromkreis von der
Energiequelle (Unterwerk) wird geschlossen durch die Stromzuführung über die
Stromschiene und die Fahrschiene zu den Fahrzeugen. Im Kleinprofil wird der
Pluspol über die Stromschiene geführt und der Minuspol über die Fahrschiene.
Im Großprofil ist dies genau umgekehrt. (Zwischen und entsprach die
Polarität der Ost-Berliner Kleinprofillinie A dem Großprofil, somit der Linie
E)
Jeder weiß, dass das Berühren der Stromschiene tödliche Folgen hat. Dieser
Umstand würde auch auf die Fahrschiene zutreffen, da sie genauso unter Strom
steht. Die tödliche Gefahr besteht bei der Fahrschiene nur deshalb nicht, weil
Fahrschienen grundsätzlich geerdet sind.
Pony
BVG-Jargon für einen aus zwei Wagen
bestehenden Kurzzug. (Üblich auf der U4)
Potsdamer Straße
BVG-umgangssprachliche Bezeichnung für die BVG-Hauptverwaltung
PreMetro
International einheitlicher Begriff für
eine Stadtschnellbahn, die aus einer Straßenbahn heraus entwickelt wurde und
nur auf Abschnitten als U-Bahn betrieben wird. Zumeist ist eine PreMetro nur ein
Zwischenstadium, bevor dieses Verkehrsmittel zu einer reinen U-Bahn ausgebaut
wird. So geschehen in Frankfurt/M. bei der dortigen U4. Der deutsche Begriff für
eine PreMetro ist "Stadtbahn". Stadtbahnen verkehren u.a. in Hannover,
Frankfurt, Essen, Köln und Stuttgart.
Preußische Kappen
Typisch auf den Kleinprofil-Altbaustrecken sind die Tunneldecken aus Wölbkappen.
Sie sind jeweils zwischen zwei Stahlträgern eingefasst. In gleicher Form sind
viele Bahnhofsdecken gestaltet. Mit Ausnahme der Wilmersdorfer U-Bahnhöfe (U1)
sind fast alle Altbaubahnhöfe des Kleinprofils mit Preußischen Kappen
ausgestattet.
Prototyp
U-Bahnwagen oder U-Bahnzug einer neuen Generation. Hierbei handelt es sich um
Vorserienzüge, das heißt um Züge, die zunächst mit der Waggon-Industrie
zusammen entwickelt wurden und als Einzelstück gebaut und zunächst in der
Praxis, auch mit Fahrgästen, getestet werden. Ein Prototyp zum Beispiel war die
Einheit 2500/2501, die als neue Baureihe F eingruppiert wurde. Ab
wurde dieser Zug fast unverändert in Serie gebaut.
Pumpensumpf
Grubenartige Vertiefung im U-Bahntunnel, in dem das gesamte Grund-, Regen- und
Brauchwasser gesammelt wird und ab einem gewissen Pegelstand mittels Pumpen in
die städtische Kanalisation entsorgt wird.
Putzarchitektur
Architektonische Ausgestaltung, wobei auf Wandfliesen in jeder Form (meist aus
Kostengründen) verzichtet wird und dafür die Wandflächen durch Hervorhebung
von Friesen, Rahmen und ähnlichem aufgelockert wird. Alfred Grenander
gestaltete mit Hilfe der Putzarchitektur die Bahnhöfe der > Nord-Süd-Bahn
(Heute: U6). Viele Bahnhöfe dieser Art sind heute noch erhalten.
R
RAW Schöneweide
Das Reichsbahnausbesserungswerk hat für die
Berliner U-Bahn seit den 50er Jahren Wartungsarbeiten übernommen. Hier wurden
alle U-Bahnwagen der BVG-Ost hauptuntersucht. Außerdem wurden hier die
allermeisten U-Bahnwagen des Typs E-III gebaut.
Reparationen
Im Völkerrecht seit dem 1. Weltkrieg
Begriff für materielle oder finanzielle Leistungen, die eine besiegte Seite der
Siegermacht als Ersatz für die Kriegsfinanzierung erbringen muss. Beide
deutschen Staaten hatten nach Ende des 2. Weltkriegs an die Siegermächte
Reparationsleistungen zu erbringen. Mit Beginn des Marshallplans im Jahre
wurden materielle Leistungen nicht mehr erwartet, stattdessen erbrachte die
Bundesrepublik noch bis Geldbeträge als Wiedergutmachung auch für Gräueltaten
am jüdischen Volk. Die Ostzone bzw. die spätere DDR hatte noch viele Jahre
Reparationsleistungen an die Sowjetunion zu erbringen.
Auch die BVG hatte Reparationsleistungen zu erbringen: Im Spätsommer gab die BVG 120 U-Bahnwagen des Typs C an die Moskauer Metro ab. Siehe > Moskauer Züge
Reuter, Ernst ( - )
Regierender Bürgermeister von Berlin ( - )
Der in Apenrade geborene R. wuchs in Friesland auf und kam über Umwege
nach Berlin. Seit gehört er, nach einem Intermezzo bei der KPD, der SPD
an. Seit gehört er als Stadtrat für Verkehrsfragen dem Magistrat von
Berlin an. In dieser Zeit sorgte er für eine Überführung der privaten
Verkehrsträger in städtische Hand und anschließend für die Gründung der
BVG. Auch entstanden auf seine Initiative hin in dieser Zeit sehr viele
U-Bahnbauten. verließ er Berlin, um in Magdeburg Oberbürgermeister zu
werden. Die Nationalsozialisten enthoben ihm des Amtes und sperrten ihn ins
Konzentrationslager Lichtenburg. Nur der Fürsprache englischer Freunde zufolge
wurde er aus der Haft entlassen, woraufhin er Deutschland verließ.
Zunächst ging er nach London und kurz darauf nach Ankara, wo er für die
türkische Regierung tätig war. Schon äußerte er die Befürchtung, dass
es Krieg geben wird und es anbetracht der zu erwartenden Trümmerberge viel
Arbeit geben wird. Er sollte recht behalten. Ende kam er wieder nach
Deutschland zurück und war kurze Zeit in Hannover, bevor er wieder nach Berlin
ging. Hier war er wieder für Verkehrsfragen zuständig, ehe er zum
Oberbürgermeister von Groß-Berlin gewählt wurde. Die Sowjets aber
verhinderten seine Amtsaufnahme, weshalb er zunächst von Louise Schröder und
Ferdinand Friedensburg vertreten werden musste. Legendär wurde R. mit seiner am
9. September gehaltenen Rede anlässlich einer Kundgebung vor dem
Reichstag, als er die "Völker der Welt" anhielt, die Stadt nicht
preiszugeben - es war die Zeit der Blockade. Nachdem der Magistrat gespalten
war, konnte Reuter als Oberbürgermeister für die Westsektoren sein Amt
aufnehmen. Neben den vielen Problemen in diesen Jahren, sorgte er auch wieder
für die Aufnahme von U-Bahnbauarbeiten, die kurz nach seinem Tode begannen.

Ernst Reuter während seiner Rede
"An die Völker der Welt" Sept.
Rheingau-Viertel
Um begonnenes gehobenes Wohngebiet für die gutbürgerliche Wilmersdorfer
Stadtbevölkerung. Anfänglich als Wohngebiet "Wilmersdorfer Südgelände"
bezeichnet. wurde zur Erschließung unter gleichzeitigen Verzicht auf Straßenbahnen
die > Wilmersdorfer U-Bahn eröffnet. Über ein Siedlungsfragment um den Rüdesheimer
Platz kam das Projekt vor dem WK I nicht hinaus. Erst in den 20er und 30er
Jahren konnte die Siedlung, allerdings baulich bescheidener, vollendet werden.
Weite Siedlungsgebiete dagegen blieben bis heute unbebaut und werden als
Schrebergartengebiete genutzt.
Umgrenzt von Laubacher- , Kreuznacher- und Schlangenbader Straße sowie der Ringbahn.
Richard-Wagner-Tunnel
A-H-Tunnel, angelegt als
Verbindungstunnel zwischen der Kleinprofillinie U2 (früher: Linie A) und der
Großprofillinie U7 (früher: Linie H).
Richtungsbetrieb
Anlage eines U-Bahnhofs, wobei der
Zugverkehr mehrerer Linien an einem Bahnsteig in einer Richtung abgewickelt
wird. Klassisches Beispiel für den R. ist der U-Bahnhof Mehringdamm wo die Züge
in selber Richtung nach Mariendorf und Rudow vom gleichen Bahnsteig abfahren.
(im ggs. zum "Linienbetrieb")
Rixdorf
Ursprünglicher Name des heutigen Stadtteils Neukölln. Rixdorf entstand aus
zwei Ortschaften: dem Deutschen Ort an der heutigen Karl-Marx-Straße sowie dem
böhmischen Ortsteil um den Richardplatz. erhielt das längst vereinigte
Rixdorf die Stadtrechte. Die Stadtoberen waren mit dem provinziellen Namen aber
nicht zu frieden und ersuchten beim Kaiser die Genehmigung zu einer Namensänderung.
wurde diesem Wunsch stattgegeben: Rixdorf durfte sich fortan "Neukölln"
nennen, wurde aber schon acht Jahre später ein Stadtteil von Berlin. Schon seit
etwa träumte man in Rixdorf von einem U-Bahnanschluss, doch erst ging
dieser Wunsch in Erfüllung.
Rolltreppen
Die ersten Rolltreppen Berlins gab es im Warenhaus Tietz an der Leipziger
Straße im Jahre . Bei der U-Bahn kamen die ersten Rolltreppen im Jahre
auf. Sie befanden sich am Bahnhof Hermannplatz zwischen den beiden
Bahnsteigebenen. Weitere Rolltreppen kamen am Kottbusser Tor zum Einsatz,
es folgten Alexanderplatz und Gesundbrunnen. In Gesundbrunnen waren für
Jahrzehnte die längsten Rolltreppen Berlins zu bewundern. Diese Treppen waren
damals noch reine Tischlerarbeit: sie waren aus Holz gefertigt. Die letzten
Treppen dieser Art verschwanden . Heutige Rolltreppen sind wegen der
Brandgefahr aus Metall. Sie kamen seit Anfang der 60er Jahre bei Neubauten und
dann auch als Nachrüstung zum Einsatz. erhielt z.B. der wichtige Bahnhof
Wittenbergplatz Rolltreppen.

Abb: Die ersten Rolltreppen bei der Berliner U-Bahn am
Hermannplatz
"Rotjacken"
Abwertende Bezeichnung der BVGer für Mitarbeiter der BVG-Fahrdiensttochter
"Berlin Transport"
Rümmler, Reiner-Gerhard
Architekt ( - )
In seiner Funktion als Senatsbaudirektor war er auch für viele Hochbauten in
West-Berlin verantwortlich.
R. entwarf zwischen und bis auf die Ausnahmen Schlossstraße und
Siemensdamm alle (West-) Berliner U-Bahnhöfe.
Sein letztes Schaffenswerk war der Bahnhof Hermannstraße (U8). Seine frühen
Entwürfe, wie etwa Möckernbrücke und Yorckstraße (U7) waren noch sehr
schlicht gehalten und repräsentierten einen sehr sachlichen Stil der 60er
Jahre. In der Folgezeit passte er seine Entwürfe für Neubauten dem Zeitgeist
an und ging damit den umgekehrten Weg wie Grenander, der das gegenteilige Ziel
einer immer klareren Architektursprache ging. Für die frühen 70er Jahre seien
hier die herausragenden Entwürfe Fehrbelliner Platz (U7) und Rathaus Steglitz
(U9) genannt, die im damals typischen Pop-Art-Design gehalten sind. Rümmlers
Entwürfe gipfelten schließlich in Ausführungen, wie Paulsternstraße und
Rathaus Spandau. Um Rümmlers Baustilanpassung im laufe der Jahre zu studieren, empfiehlt
sich eine Fahrt mit der U7 von Mehringdamm nach Spandau, durchweg Bahnhöfe, die
zwischen und entstanden oder alternativ mit der U8 von Pankstraße
nach Wittenau ( - ). Erst mit seinem allerletzten Entwurf, dem Bahnhof
Hermannstraße (U8), näherte er sich wieder dem Grenanderschen Spätstil an.
Rundenläufer
U-Bahnzug, der frisch überholt nach einer HU erstmals wieder zum Einsatz kommt.
Hierzu läuft er zwei Runden auf der Linie U9, bevor er wieder auf seine
Stammlinie umgesetzt wird.
S
Sanden
Stahlräder haben auf Stahlschienen die
Eigenschaft, bei Feuchtigkeit und Herbstlaub durchzudrehen bzw. beim Bremsen zu
blockieren. Um dies zu verhindern, besitzen Schienenfahrzeuge eine
Sandungsanlage, bestehend aus einem Sandkasten und einer Sanddüse von den
Antriebsachsen. Diese Anlage wird mit Druckluft aus der Füllleitung der
Bremsanlage versorgt und bläst Sand vor die Antriebsräder, wodurch diese auf
den Schienen wieder greifen können.
S-Bahn
1. Abkürzung
für "Stadt- Ring- und Vorortbahn"
2. Vom
Wesen her mit der U-Bahn vergleichbares Massenverkehrsmittel. S-Bahnen werden
von der Deutschen Bahn (oder Tochterunternehmen) betrieben und wurden von ihren
Vorgängern Bundesbahn und Reichsbahn eingerichtet, was sie wesentlich von einer
U-Bahn unterscheidet. Zumeist entstanden sie aus Fernbahnen heraus. Die
klassischen S-Bahnen in Hamburg und Berlin werden mit Gleichstrom aus der
Stromschiene wie eine U-Bahn betrieben. Die neueren S-Bahnen fahren mit
Wechselstrom und Oberleitung.
S-Bahnen gibt es außer in Berlin noch in Hamburg (die beiden einzigen mit
Gleichstrom), in München, Stuttgart, Frankfurt (M), Düsseldorf und Hannover.
Weitere S-Bahnbetriebe in Deutschland werden nicht mit >Triebzügen
sondern mit Wendezügen durchgeführt, womit sie im Grunde keine echten
S-Bahnbetriebe mehr sind. (Leipzig, Halle, Rostock, Ruhrgebiet)
Der Begriff "S-Bahn" wurde von der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft für die "elektrische Stadt- Ring- und
Vorortbahn" in Berlin eingeführt, wenig später für die "elektrische
Stadt- und Vorortbahn" in Hamburg übernommen.
S-Bahn, Berliner
Die Berliner S-Bahn entstand aus der
sogenannten "Stadt-, Ring- und Vorortbahn" heraus. Schon vor der
Jahrhundertwende hatte Berlin enorme Verkehrsströme im Vorortbereich. Da das
Straßenbahnnetz sich vornehmlich auf das Stadtgebiet konzentrierte, hatte die
Preussische Eisenbahn die Aufgabe, die Pendler zu befördern. Hierzu gab es mit
speziellen Dampflokomotiven bespannte Personenzüge, die bis weit in das Umland
hinaus fuhren. Schon um wurden erste Versuche unternommen, diese Strecken
zu elektrifizieren. Zumeist wurde hierzu die seitliche Stromschiene verwendet.
Insgesamt gab es drei Versuchsstrecken, doch nur eine blieb bis Ende der 20er
Jahre in dieser Form in Betrieb.
Schon vor dem ersten Weltkrieg wurden Untersuchungen angestellt, wie das gesamte Streckennetz der Vorortbahnen elektrifiziert werden könnte, Bauvorbereitungen begannen um auf der Strecke nach Bernau, es sollte ein Oberleitungsbetrieb eingerichtet werden. Doch es kam anders: schließlich wurde die Bernauer Strecke als erste S-Bahnstrecke im heutigen Sinne elektrifiziert. Es folgten in den darauf folgenden Jahren die Nordstrecken nach Oranienburg und nach Velten. Die Versuche auf diesen Strecken verliefen so gut, dass die Reichsbahn ein umfangreiches Elektrifizierungsprogramm beschloss, welches ab zielstrebig umgesetzt wurde. Es war die Zeit der sprichwörtlichen "Großen Elektrisierung". Bis wurden alle wesentlichen Strecken auf Gleichstrom 800 V umgerüstet und somit der heutige S-Bahnbetrieb aufgenommen. Hierzu wurden nicht weniger als 1200 S-Bahnwagen nach einheitlichen Bauplänen von sieben Waggonbaufirmen gefertigt. In den Folgejahren gab es noch einige Streckenergänzungen, unter anderem die Nord-Süd-Tunnelstrecke, die -39 fertiggestellt wurde. Auch wurden ab für die Zeit höchst-moderne S-Bahnzüge beschafft. Die Baureihen hatten so klangvolle Namen wie "Olympia" und "Bankier". Die "Bankierzüge" zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h schafften, während die normalen Züge nur 80 km/h liefen. Obwohl es weitergehende Planungen gab, musste der Ausbau wegen des WK II zurückgestellt werden. Berlin besaß mit der S-Bahn in jener Zeit das leistungsfähigste und modernste Massenverkehrsmittel überhaupt.
Selbstverständlich hat die S-Bahn den Krieg auch nur schwer zerstört überstanden. Doch damit nicht genug: Hatte man doch genug mit dem Wiederaufbau zu tun, wurde von den Alliierten bestimmt, dass die S-Bahn der Ostzonalen Eisenbahnverwaltung zugesprochen wurde - wohlgemerkt: Auch die S-Bahn im späteren Westteil der Stadt. Dies hatte Folgen! Die S-Bahn sollte und musste von der "Deutschen Reichsbahn" betrieben werden. Und nur aus diesem Grund hat es noch bis zur Wiedervereinigung eine Eisenbahngesellschaft namens "Deutsche Reichsbahn" gegeben - Die Berliner S-Bahn war schuld, denn sicher hätte die DDR ihre Eisenbahn gern anders bezeichnet.
Anfänglich, also in den ersten Nachkriegsjahren, war die S-Bahn ein allseits sehr beliebtes Verkehrsmittel. Das Netz wurde sogar noch erweitert, auch in Westberlin. Warum dies in Westberlin geschah, ist wiederum eine Geschichte für sich, hatte natürlich auch politische Gründe. Jedenfalls war die Reichsbahn mit den Umständen sehr zufrieden, denn hierdurch hatte die DDR zumindest einen Fuß im politisch gehassten Westberlin. Dies wurde ausgenutzt: Nicht nur einmal wurde auf Westberliner S-Bahnhöfen die DDR-Flagge gehisst. Zwangsläufig kam es zu Zwischenfällen, die politische Tragweite annahmen: Wer hat auf den Bahnhöfen Hausrecht? Es wurde leidenschaftlich gestritten, ob es die Bahnpolizei der DDR ist oder die Westberliner Polizei...
Doch dann kam der Mauerbau und damit für die S-Bahn zumindest im Westteil der Stadt eine völlig absurde Situation: Westliche Gewerkschaften und Zeitungen riefen nach dem Mauerbau zum Boykott der S-Bahn auf; die BVG hatte enorme Schwierigkeiten, die vielen neuen Fahrgäste zu befördern. Aber man war sich einig: "Mit der S-Bahn fährt man nicht!" "Wer S-Bahn fährt, zahlt Ulbrichts Stacheldraht!" ...so lauteten die Parolen.
Im Laufe der Jahre verschlechterte sich der Zustand der Züge und Anlagen immer mehr, die S-Bahn war aus dem Bewusstsein der Westberliner weitgehend verschwunden, selbst in der Rushhour ratterten die alten Züge menschenleer durch die Stadt. Es war ein seinesgleichen suchender Anachronismus der da entstanden war. Erst als die DR den Betrieb erheblich beschränkte und schließlich ganz einstellen wollte, setzten sich höchste Vertreter aller Seiten an den Tisch. Überraschend schnell gab es Ergebnisse, die dazu führten, dass die S-Bahn in Westberlin am 9. Januar von der BVG übernommen wurde. Die BVG investierte sehr viel Geld in den völlig heruntergewirtschafteten Betrieb und brachte die S-Bahn erstmalig wieder in das Bewusstsein der Bürger. Die Berliner söhnten sich mit der S-Bahn wieder aus, auch wenn der Streckenwiederaufbau nicht so schnell wie gewünscht voran ging. Erst nach der politischen Wende in Deutschland wurden entscheidende Netzlücken wieder geschlossen. Es entstand im Laufe der Jahre wieder ein höchst modernes Verkehrssystem, was an alte Traditionen durchaus anknüpfen kann, auch wenn die legendären alten "Stadtbahner" längst auf dem Schrott gelandet sind.
S-Bahnnetz in einer Netzspinne der Deutschen
Reichsbahn von
SBU
"Signalbuch U-Bahn"
Regelwerk mit bildlicher Darstellung aller Signalbilder für bedienstete
Mitarbeiter im U-Bahn-Fahrdienst der BVG.
Schachbrett
BVG-Jargon für das alte Signal A5. Es ist eine "Abfertigungstafel"
und wenn diese leuchtet, bedeutet dies für den Zugbegleiter, dass der
betreffende Bahnhof personell nicht besetzt ist, der Zugbegleiter den
Abfertigungsvorgang anstelle eines Zugabfertigers übernehmen muss. Zuletzt gab
es das "Schachbrett" auf dem Bahnhof Friedrichstraße der U6 während
der Mauerzeiten.

Schaudt, Johann Emil
Architekt
Entwarf den heutigen U-Bahnhof Rathaus Schöneberg.
Schauläden
Das waren nichts anderes als Schaufenster. Als Schauläden wurde die
Schaufenster in der Passage unter dem Alexanderplatz bezeichnet.
Schildvortrieb
"geschlossenes" Bauverfahren zur
Herstellung von U-Bahntunneln in "Geschlossener Bauweise".
Zur Herstellung wird ein "Vortriebsschild" verwendet, der sich ähnlich
einer Bohrmaschine durch das Erdreich arbeitet. Hinter dem Schild, das
vollautomatisch arbeiten kann, entsteht der fertige Streckentunnel. (siehe auch:
Geschlossene Bauweise)
Schlesien
Umgangssprachlich für den U-Bhf.
Schlesisches Tor. Stellvertretend werden vom Fahrpersonal viele U-Bahnhöfe ähnlich
abgekürzt. Wenn also ein Zugfahrer der U6 "Reinickendorf" sagt, meint
er also nicht den Stadtteil sondern den U-Bhf. Reinickendorfer Straße.
Schlupftür
Tür zwischen Fahrer- und Fahrgastraum.
Schmetterlings-Decke
Fachspezifischer Begriff für die Gestaltungsform einiger Bahnhofs-Decken in den
50er und 60er Jahren.
Es handelt sich um eine abgehängte Einbaudecke, die über der Bahnsteigkante in
Bahnhofs-Längsachse gewölbt ist, ihre Tiefpunkte an den Tunnelwänden und den
Mittelstützen hat. Es gibt mehrere Varianten dieser Deckenform: Die
gleichmäßige Wölbung, wie etwa am Hansaplatz, die einem Segmentbogen gleich
kommt, oder die scharfkantige Wölbung mit gleichmäßigem Anstieg wie etwa an
der Amrumer Straße. S.-Decken finden sich auf der U9 zwischen Spichernstraße
und Amrumer Straße und auf der U6 zwischen Rehberge und Alt-Tegel. Varianten
dieser Deckenform finden sich am Mehringdamm und sogar in Hamburg: Straßburger
Straße, Lohmühlenstraße (beide U1; , ) und Jungfernstieg (S-Bahn;
)
Schöneberger U-Bahn
Deckungsgleich mit der heutigen U4. -10
im Auftrage der damals selbständigen Stadt Schöneberg erstellte und von ihr
selbst finanzierte U-Bahnstrecke zwischen Nollendorfplatz und Innsbrucker Platz
zur Erschließung des damals im Bau befindlichen großbürgerlichen
"Bayerischen Viertels" angelegt. Die Inbetriebnahme erfolgte im
Dezember . Anfänglich betrieblich unabhängige Strecke mit eigenen
Fahrzeugen, konnte somit als die zweite deutsche U-Bahn nach der Berliner U-Bahn
angesehen werden. erfolgte durch den Bau der "Entlastungsstrecke"
die Einbindung der Schöneberger U-Bahn in das Berliner U-Bahnnetz. (Ursprüngliche
Gesamtlänge: 2,9 km mit zusammen 5 Bahnhöfen)
Schüler, Ralf (und Witte,
Ursulina)
Architekten, entwarfen die U-Bahnhöfe Schloßstraße
(U9) und Siemensdamm (U7)
Schütz/
Trennschütz
Ein Schütz wird mit elektromagnetischer Kraft (110 V) angesteuert und öffnet
oder schließt einen Stromkreis (750 V) z. B. den Fahrmotorenstromkreis,
Umformereinschaltung, Lüftereinschaltung, Kompressor.
Schutzanlagen
Als S. wurden die Bunkeranlagen im Bereich der Berliner U-Bahn bezeichnet. Davon
gibt eine ganze Menge, doch abgesehen von den in den 70ern erbauten Bahnhöfen
Pankstraße und Siemensdamm handelt es sich um nachträglich eingefügte
Baulichkeiten aus den 30er und 40er Jahren.
Schutzraum
Bereich für Bauarbeiter außerhalb des
"Lichtraumprofils" eines U-Bahnzuges.
Schutzstrecke
Gleisabschnitt zwischen einem halt-zeigendem
Signal und einem tatsächlichen oder zu vermutenden Hindernis im Gleis.
Innerhalb einer Schutzstrecke kann ein U-Bahnzug zum Halten gebracht werden,
ohne dass es zu einem Zwischenfall kommt.
Schwelle
Zum Tragen der Schienen werden generell Holzschwellen verwendet. In
Tunnelstrecken handelt es sich um getränkte Kiefernschwellen, auf
Hochbahnabschnitten um Eichenschwellen. Der jeweilige Schwellenabstand beträgt
in der Geraden 790 mm, in Kurven mit einem Halbmesser von unter 500 Metern
dagegen 655 mm. In der Geraden trägt jede siebte Schwelle den
Stromschienenbock.
Beim Bau der U-Bahnlinie E nach Hönow (-89) wurden industriell gefertigte Betonschwellen verwendet, wie sie auch bei der Deutschen Reichsbahn in jener Zeit Anwendung fanden. Ebenso wurden in den 60er Jahren Versuche mit Betonschwellen und sogar schwellenlosen Oberbauten bei der U-Bahn in West-Berlin gemacht. Da diese Versuche aber keinen nennenswerten Erfolg brachten, kehrte man zum althergebrachten Holzschwellenoberbau zurück.
Schwenkschiebetür
Konstruktion der Tür, wobei diese an der Aussenhaut des Fahrzeugs
entlang läuft. Beim Schließvorgang schwenkt die Tür in die Türöffnung ein
und schließt bündig mit der Aussenhaut des Fahrzeugs ab. Der Grund für diese
Türkonstruktion ist die leichte Sauberhaltung der Fahrzeugaussenwand.
Seeparkbrücke
Brückenkonstruktion unter der heutigen Barstraße (heute "Barbrücke"
genannt) für die Wilmersdorfer U-Bahn in der Zeit zwischen und 13
angelegt. Die S. überbrückt das moorige Gelände des "Wilmersdorfer
Fenngrabens" und musste demzufolge tief gegründet werden. Da die Stadt auf
Wandelgänge und eine dekorative Gestaltung des Bauwerks nicht verzichten
mochte, geriet das Bauwerk für den weichen Untergrund viel zu schwer. Schon
bald zeigten sich Bauwerkssetzungen. Aus diesem Grunde musste das gesamte
Bauwerk bereits in den 30er Jahren völlig umgebaut werden unter Verzicht der
Wandelgänge. Heute ist dieses Bauwerk belangloser Bestandteil des
Streckentunnels zwischen den Bahnhöfen Fehrbelliner- und Heidelberger Platz.
Ursprünglich war die Seeparkbrücke die Wilmersdorfer Antwort auf den Schöneberger
U-Bahnhof Stadtpark (heute U-Bhf Rathaus Schöneberg), der
konstruktionstechnisch vergleichbar und noch heute erhalten ist.
Seitenbahnsteig
S.e liegen in einem solchen Bahnhof außerhalb
der Streckentrasse, an dessen Seite. Von einem S. fahren die Züge stets nur in
eine Fahrtrichtung. Auch "Außenbahnsteig" genannt. (siehe auch
"Mittelbahnsteig") Ein Beispiel für einen Bahnhof mit
Seitenbahnsteigen ist der U-Bahnhof Augsburger Straße.
Sektoren
Berlins Stadtgebiet wurde entsprechend den
Beschlüssen des Londoner Protokolls und der Beschlüsse von Jalta in vier
sogenannte "Besatzungssektoren" aufgeteilt. Die Sektorengrenzen
orientierten sich hierbei streng an den gegebenen Stadtbezirksgrenzen in ihrem
Zustand von . (Gebietsreform der bei der Gründung von "Groß-Berlin"
gebildeten 20 Stadtbezirke)
Nach Kriegsende war Berlin vollständig von sowjetischen Truppen besetzt. Erst ab 4. Juli rückten Briten und Amerikaner als westalliierte Schutzmächte in ihre Sektoren ein. Die Briten besetzten zunächst auch die beiden Stadtbezirke Wedding und Reinickendorf, gaben diese aber am 12. August vereinbarungsgemäß an die Franzosen ab.
Die Schutzmächte hatten in ihren Sektoren uneingeschränkte Machtbefugnisse, die noch über der Gesetzgebung der beiden deutschen Teilstaaten lagen.
In dieser Form hatte das Besatzungsstatut Gültigkeit bis zum Ablauf des 2. Oktober .
Ab kam es zu kleineren Grenzkorrekturen, die in den meisten Fällen durch Gebietstausch zu stande kamen. So wurden fast alle auf DDR-Gebiet liegenden Exklaven entweder mit dem West-Berliner Stadtgebiet zusammengefasst oder an die DDR abgegeben: kam der ehemalige Potsdamer Bahnhof und das sogenannte "Lenné-Dreieck" zu West-Berlin. Die "Wüste Mark", südwestlich von Zehlendorf, zur DDR...
Die DDR ihrerseits ordnete in den 80er Jahren einige Stadtbezirke neu, was jedoch den westlichen Schutzmächten missfiel. So wurden die Stadtbezirke Hohenschönhausen, Marzahn und Hellersdorf neu gebildet. Insgesamt hatte dies jedoch keine Auswirkungen auf die Sektoren an sich.
Die drei westlichen Besatzungssektoren wurden sehr bald zusammenfassend als die "Westsektoren" bezeichnet, während die DDR ihren "Ostsektor" als den "Demokratischen Sektor" bezeichnete. (Siehe > demokratisches Berlin)

Sektorengrenze
Das Stadtgebiet Groß-Berlins war nach Kriegsende von zahlreichen
Sektorengrenzen durchzogen. Während die Sektorengrenzen der Westsektoren immer
mehr an Bedeutung verloren, wurde die Grenze zwischen den Westsektoren und dem
Sowjetisch besetzten Sektor ab zunehmend sichtbarer: Zunächst wurde sie
durch einen weißen Strich kenntlich gemacht, bald auch durch entsprechende
Schilder. Ab war es nicht mehr möglich mit einem KFZ die Grenze unbemerkt
zu passieren. Auch für Fußgänger wurde dies immer problematischer.
entstand entlang dieser Grenze auf östlicher Seite die Mauer. Für die
alliierten Mächte jedoch hatte die Sektorengrenze niemals eine behindernde
Funktion: Sie durften jederzeit jeden der vier Sektoren besuchen und durften
hierbei niemals kontrolliert werden. Aus diesem Grunde gab es am
"Checkpoint Charlie" besondere Abfertigungsspuren, die für das
DDR-Grenzregime tabu waren. Hier taten die Alliierten selbst dienst.
Seltrac
Von der Fa. Standard Elektronik Lorenz (SEL) entwickeltes "Automatisches
Betriebsablaufsteuerungssystem (Seltrac)" für den vollautomatischen (und
theoretisch fahrerlosen) U-Bahnbetrieb. Wurde in Berlin ab auf einer
stillgelegten Hochbahnstrecke erprobt und ab für mehrere Jahre regelmäßig
auf der U4 angewendet. Mehrere Großrechner im U-Bhf. Nollendorfplatz steuerten
den gesamten Betriebsablauf auf dieser U-Bahnlinie.
Senator für Bau und
Wohnungswesen
Fachbehörde des Landes Berlin, die für die Erstellung der U-Bahnstrecken
verantwortlich ist. Erst nach baulicher Vollendung wird der Streckenabschnitt an
die BVG übergeben.
Der Bausenat wurde kürzlich umgebildet und heißt heute "Senat für Bauen,
Wohnen und Verkehr".
Senator für Verkehr und
Betriebe
Fachbehörde des Landes Berlin, der die BVG als Eigenbetrieb unterstellt war.
Siebenhundert
Funkkürzel zur Verständigung zwischen
Zugfahrer und Leitstelle, damit ein Ersatzfahrer bereitgestellt werden kann, da
dem 700-gebenden Zugfahrer ein Menschliches Bedürfnis plagt.
SIFA (Sicherheits-Fahrschalter)
Sicherheitsschaltung, die eine
Schnellbremsung des Zuges auslösen kann. Der Zugfahrer muss einen bestimmten
Taster stets betätigen, um den Zug zu bewegen. Tut er dies nicht, wird der Zug
zwangsgestoppt, um Unfälle zu vermeiden. Diese Schaltung dient der Sicherheit,
falls der Fahrer während der Fahrt bewusstlos werden sollte. Ein Zugfahrer verfügt
über zwei solcher Taster: Einen auf dem Fahrerpult sowie einen zweiten, der mit
dem Fuß zu betätigen ist.
Signal
Ein S. im Sinne des Signalbuchs ist jede Form der bildlichen Darstellung von
Fahraufträgen und Befehlen an das Zugpersonal. Somit also nicht nur die
leuchtenden Lampen, sondern auch alle Beschilderungen.
bei den leuchtenden Signalen, die die Weiterfahrt erlauben oder verbieten,
unterscheidet man Streckensignale als Hauptsignale oder als Vorsignale. Dann
gibt es noch Ausfahrtsignale, Einfahrtsignale und Vorsignale und nicht zu
vergessen die Stellwerkssignale. Früher gab es noch Nachrücksignale. Näheres
wird in einem gesonderten Beitrag für
Signale erklärt.
SiK
Abkürzung für "Schaffner im Kontrolldienst"
Fahrschein-Kontrolleur
SIS-Leitstelle
Abkürzung für "Sicherheits-, Informations- und Servicezentrale"
Mehrere dieser SIS-Leitstellen sind auffällig über das U-Bahnnetz verteilt.
Sie sind bei Problemen erster Ansprechpartner für Fahrgäste. Die SOS-Säulen
auf den U-Bahnhöfen sind mit der nächstgelegenen SIS-Leitstelle verbunden.
SO
Abk. für "Signalordnung" Heute "SBU" genannt.
Die Signalordnung war früher ein kleines blaues Büchlein, in dem die Signale
erklärt waren. Aktualisierungen wurden einfach eingeklebt. Beim heutigen SBU
handelt es sich um eine geheftete Loseblattsammlung, deren Blätter im
Bedarfsfall auszuwechseln sind.
SOS-Säule
Informationssäule auf den Bahnsteigen. Der Fahrgast kann mittels entsprechender
Rufknöpfe Fragen an die > zuständige SIS-Leitstelle richten aber auch
Notrufe absetzen.
Spittelmarkt-Strecke
U-Bahnstrecke der U2 zwischen Potsdamer
Platz und Spittelmarkt, bis eröffnet.
Spreetunnel
1. Eingleisiger Röhrentunnel der Berliner
Ostbahnen (Straßenbahn), in Betrieb genommen, stillgelegt, später
zugeschüttet. Erste bergmännisch aufgefahrene Flussunterfahrung in
Deutschland.
2. U-Bahntunnel im Zuge der U2 zwischen den Bahnhöfen
Märkisches Museum und Klosterstraße. In offener Baugrube erstellt, in
Betrieb genommen. Erste Flussunterfahrung einer U-Bahn in Deutschland.
Spurweite
Die Spurweite der Gleise der Berliner U-Bahn beträgt, wie bei den
mitteleuropäischen Eisenbahnen üblich, 1435 mm. Ermittelt wird die Spurweite
anhand des Abstandes der Innenkanten der Schienen zueinander.
Stadion-Stellwerk
Größtes elektromechanisches Hebelstellwerk Europas. Es wurde im August in
Betrieb genommen. Von diesem Stellwerk aus, dass im Obergeschoss des Empfangsgebäudes
des U-Bahnhof Olympia-Stadion untergebracht ist, wurde der gesamte Zugbetrieb
auf dem Gelände der Haupt- und Betriebswerkstatt Grunewald überwacht und
gesteuert. wurde das Stellwerk außer Betrieb genommen und durch einen
Neubau ersetzt. Es drohte der Abriss der alten Anlage, doch einige beherzte
BVGer und > AG-U-Bahner retteten dieses Stellwerk vor der Spitzhacke und
machten daraus Deutschlands erstes U-Bahnmuseum.
Stadionstrecke
U-Bahnstrecke der U2 zwischen
Theodor-Heuss-Platz und Olympia-Stadion. Die Strecke wurde -12 erbaut, ab
gelegentlich und ab regelmäßig befahren.
Stadtbahn
1. Neudeutscher Begriff für eine >"preMetro" oder "U-Straßenbahn",
also eine Straßenbahn, die in inneren Stadtgebieten auf U-Bahnparameter
ausgebaute Streckentunnel benutzt, im übrigen aber im Straßenbereich fahren
kann. Stets benutzt eine Stadtbahn eine Oberleitung, besitzt Bremslichter und
Blinker, womit sie straßentauglich ist, was sie wesentlich von einer
"echten U-Bahn" unterscheidet. Stadtbahnen (mancherorts
"U-Bahn" genannt) gibt es u.a. in Hannover
(seit ), Frankfurt a.M. (seit ), Köln (seit ) Bonn (seit ),
Dortmund (seit ), Essen (seit ), Mülheim (seit ), Düsseldorf (seit
) und Stuttgart (seit ). Manche Städte planen noch heute den Ausbau von
Stadtbahnen zu echten U-Bahnen, andere, wie Hannover, haben die ideale Lösung
ihrer Verkehrsprobleme mit dem Bau einer Stadtbahn gefunden und haben den endgültigen
Ausbau zur echten U-Bahn mittlerweile verworfen.
Der Begriff "Stadtbahn" tauchte erstmals im Ruhrgebiet auf, wo man
bereits in den 60er Jahren eine "Stadtbahn Ruhr" entwarf, die komplett
auf eigenen Gleiskörpern, aber nur in städtischen Verdichtungsräumen
unterirdisch verkehren sollte. Faktisch sollten dort U-Bahnzüge (Arbeitstitel:
"Stadtbahnwagen A") zum Einsatz kommen, wie sie etwa auch in Berlin
verkehren, aber auf Grund der enormen Baukosten strich man das Projekt im Laufe
der Jahre immer weiter zusammen, so dass nur einzelne Abschnitte bislang
ausgebaut wurden.
2. In Wien gibt es seit eine vom übrigen Verkehr unabhängige
Schnellbahn, die als "Wiener Stadtbahn" bezeichnet wurde. Sie wurde in
den 70er und 80er Jahren zu einer reinen U-Bahn umgebaut.
3. Begriff für die seit in Betrieb befindliche und auf über 700
Viaduktbögen gebaute Eisenbahnstrecke, mit der die Stadt Berlin sowohl mit der
S- als auch mit der Fernbahn durchquert werden kann.
Stahldora
BVG-Umgangssprachliche Bezeichnung für die
Großprofil-Züge der Bauart D, deren Wagenkasten aus Stahl gefertigt war. (Bei
den DL-Zügen "Dora" aus Aluminium)
Stammstrecke
Zusammengefasster Begriff für die erste
Hochbahnstrecke in Berlin, eröffnet von Warschauer Straße bis zum
Ernst-Reuter-Platz, heute von der U1 und U2 befahren. Die Stammstrecke wird
unterscheiden in > Östliche Stammstrecke und > Westliche Stammstrecke.
Beide Streckenteile treffen sich am > Gleisdreieck.
STAR
(Systemtechnik
für den automatischen
Regelbetrieb)
Mit dem Forschungsvorhaben "STAR" hat die BVG die Chance genutzt, im Rahmen eines Verbundvorhabens mit Industriepartnern (Adtranz und Siemens) grundlegend zu erforschen, ob es technisch, betrieblich und wirtschaftlich machbar ist, einen bestehenden U-Bahnbetrieb unter rollendem Rad in einen automatischen U-Bahnbetrieb zu überführen. Das Vorhaben wurde mit der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen begonnen. Seit Anfang wurde die Erprobung auf einem Streckenabschnitt der U5 (Friedrichsfelde - Biesdorf-Süd) vorbereitet. Zwischen November und April fand ein Versuchsbetrieb auf dieser Strecke mit H-Zügen statt. Zwischenzeitlich wurde das Projekt STAR zu den Akten gelegt, da es in erster Linie wegen der Finanzierung zur netzweiten Einführung zur Zeit undurchführbar ist.
Wesentlicher Bestandteil des Projektes STAR ist
das automatische Steuern von U-Bahnzügen und der schnelle Eingriff in den
Betrieb bei Störungen zur Verhinderung von Unfällen, etwa durch Personen im
Gleis.
Vom 9. bis 11. Februar fand zum Thema Star in Berlin eine Fachtagung statt.
An dieser Tagung nahmen auch Mitarbeiter von U-Bahnbetrieben teil, die ebenfalls
den automatisierten U-Bahnbetrieb anstreben.
STAR II
(Systemtechnik
für den automatischen
Regelbetrieb)
Im Projekt STAR II wurden die Verfahrenstechniken und die technische Ausstattung
nochmals überarbeitet und verbessert. STAR II schloss sich zeitlich an das
Projekt STAR an und wurde im September abgeschlossen.
Stellwerkssignal
S. gibt es nur in Bahnhöfen mit Aufstellgleisen. Zumeist funktionieren diese
Anlagen vollkommen selbsttätig durch eine Programmsteuerung, wobei der
Weichensteller in das Geschehen eingreifen kann. Ein S. erkennt man an dem
senkrechten roten Balken unter dem Signal.
Steuerwagen
1. Antriebsloser Beiwagen, der über einen Führerstand
verfügt. Er kann an der Zugspitze eingesetzt werden. Zumeist entstanden die
Steuerwagen aus umgebauten Beiwagen. Gedacht waren diese Wagen für Zweiwagenzüge,
bestehend aus Steuerwagen und normalen vollmotorisierten Triebwagen.
Zuggattungen: B-II
2. Teil eines Doppeltriebwagens, der über die elektrischen Steuereinrichtungen
des Zuges verfügt. Trägt stets eine gerade Wagennummer. (wird auch
"S-Wagen" genannt)
Zuggattungen: A3, A3L, D, DL, F
Stirnwandtür
Tür in der Stirnfront aller U-Bahnzüge, die je in Berlin gefahren sind. (Außer
Typ E und G)
Sie dient zur Evakuierung des Zuges im Gefahrenfall, sowie als Durchgang
zwischen den Wagen für das Werkstattpersonal.
Streckenkenntnis
Ein U-Bahnfahrer darf einen
Streckenabschnitt nur befahren, wenn er die nötige Streckenkenntnis besitzt.
Diese erlischt nach 6 Monaten oder nach wesentlichen baulichen Veränderungen.
In diesem Falle muss er die Streckenkenntnis neu erlangen. (Seit neuestem geht
die Streckenkenntnis nicht mehr verloren.)
Streckenteile Ri - Ks bzw. Vo - Mr
BVG-offizielle Bezeichnung für die "Transitstrecken" der BVG-West
unter Ost-Berlin. (Linien 6 und 8)
Aus politischen Gründen wurde der Begriff "Transitstrecke" vermieden.
Ri, Ks, Vo und Mr waren (und sind) die Bahnhofskürzel der damals so genannten
"Grenzbahnhöfe", also der letzten Bahnhöfe in West-Berlin
Stromabnehmer
Leitendes am U-Bahnzug befestigtes Metallstück
zur Abnahme des für die Fahrt benötigten Fahrstroms.
Stromschiene
Neben dem Gleis befestigte Metallschiene zur
Bereitstellung des für den Zugbetrieb nötigen Fahrstroms. Die Stromschiene
unterscheidet sich in den beiden Profilsystemen: Im Kleinprofil ist die
Stromschiene stehend neben dem Gleis befestigt und wird von den Zügen auf der
blanken Oberseite mit den Stromabnehmer abgetastet. Im Großprofil dagegen ist
die Stromschiene an Lagerböcken hängend befestigt. Hierdurch kann die
Stromschiene von den Zügen von unten abgetastet werden.
Grundsätzlich ist eine Stromschiene in Bahnhofsbereichen auf der dem Bahnsteig
abgewandten Seite des Gleises angebracht. Dies war nicht immer so: Früher waren
-insbesondere im Kleinprofil- die Stromschienen auch unter der Bahnsteigkante
angeordnet. Dies war nicht ungefährlich: Es ist vorgekommen, das Fahrgäste,
ins besondere Gehbehinderte, beim Zusteigen gestolpert sind, wobei der
metallische Spazier- oder Krückstock mit der Stromschiene in Verbindung kam und
somit eine leitende Verbindung herstellte.
Stromspeisebezirk
(Auch Bahnspeisebezirk genannt)
Ein Stromspeisebezirk erstreckt sich in aller Regel über bis zu fünf
U-Bahnhöfe einer U-Bahnstrecke und wird zumeist nur von einem ihm
zugeordneten Unterwerk mit gebrauchsfähigen Fahrstrom versorgt. Um Engpässe
auszugleichen, können zwei benachbarte Speisebezirke zeitlich befristet auch
miteinander verbunden werden. Hierzu gibt es an den Speisebezirksgrenzen
sogenannte Kuppelstellen. Stromspeisebezirke werden nach einem im jeweiligen
Abschnitt befindlichen Bahnhof benannt. Der Speisebezirk "KM" (für
"Karl-Marx-Straße") zum Beispiel versorgt die gesamte Strecke der U7
von Hermannplatz bis Grenzallee, wird aber versorgt durch das Unterwerk "Uhp",
also vom Hermannplatz.
Die Speisebezirke im Jahre
Stromwagen
Diese speziellen U-Bahnwagen dienten einzig und allein nur dem Transport von
Kleinprofilzügen der Ostberliner Linie A (Pankow-Thälmannplatz) zur
Betriebswerkstatt Friedrichsfelde. Hierzu fuhren diese Züge über die
Großprofillinie E. Da das Großprofilnetz eine andere Stromversorgung hat, sind
Wagen erforderlich, die mit dieser Stromversorgung kompatibel sind. Diese Wagen
wurden an einen zu transportierenden Kleinprofilzug gekoppelt und stromseitig
verbunden, womit dieser Zug dann mit eigener Kraft fahren konnte. Es handelte
sich somit nicht um eine Schleppfahrt. Insgesamt gab es sieben Stromwagen, die
spezialisiert für die unterschiedlichen Kleinprofil-Zuggattungen umgebaut
waren. Sie wurden zwar ausnahmslos vor dem Krieg für den Fahrgastverkehr
gebaut, kamen als Stromwagen in Form von Arbeitszügen ab zum Einsatz. Die
letzten Stromwagen waren im Spätsommer unterwegs.
T
Taschen-Schiebetür
Herkömmliche Bauart der Fahrgasttüren, wie
sie bei den Bauarten D, DL, F (bis 79.3) sowie bei den Bauarten A3 und A3L
Verwendung fanden. Diese Türen verschwinden beim Öffnen in Taschen, also in
Hohlräumen zwischen Aussenwand und Fahrgastraum-Innenwand.
Tatzlager-Antrieb
Ein zur Fahrtrichtung quer liegender und
damit parallel zur Achse liegender Fahrmotor treibt eine einzelne Achse eines
U-Bahnzuges an. In aller Regel waren in einem Drehgestell zwei dieser
Fahrmotoren untergebracht. Ein Motor der Tatzlager-Bauart war einerseits am
Drehgestell-Rahmen frei-gelenkig montiert, und lag zur anderen Seite mit seinem
Antriebsritzel direkt auf der Achse.Hierdurch wurde das Gewicht des Motors
direkt auf die Achse übertragen.
Diese Bauform war sowohl bei den Vorkriegszügen der
U-Bahn wie auch bei der Berliner S-Bahn üblich.
Tegeler Strecke
U-Bahnstrecke der Linie U6 zwischen Seestraße
und Alt-Tegel, und fertiggestellt.
Tempelhofer Zweig
Abzweigstrecke der Nord-Süd-Bahn zwischen
Mehringdamm und Tempelhof der heutigen U6. Erbaut zwischen und .
Toter Tunnel
Unter diesem Begriff versteht man einen U-Bahntunnel, der nicht mehr oder
niemals für den U-Bahnbetrieb genutzt wird. Zumeist wurden diese Tunnel als
> Bauvorleistung erschaffen, um dort später, nach vollständigen
Streckenausbau, den regulären U-Bahnbetrieb aufzunehmen. In vielen Fällen aber
wurden die abschließenden Ausbauten nicht weiter verfolgt, so dass diese Tunnel
auf Dauer Investitionsruinen bleiben.
Tränenpalast
Der Ost-Berliner Volksmund bezeichnete in dieser Form das Abfertigungsgebäude
am Bahnhof Friedrichstraße für die ausreisenden und sich unter Tränen von den
DDR-Verwandten verabschiedenden Besuchern aus "Westberlin". Der Tränenpalast
entstand um auf dem nördlich des Stadtbahnhofs gelegenen grünen Dreieck
zur Weidendammer Brücke und war somit Bestandteil der "GÜST"
Friedrichstraße. Der Grenzübergang durfte von "Bürgern der BRD",
von "Westberlinern" und von "Ausländern" genutzt werden. Für
"Diplomaten" gab es eine besondere Abfertigungsspur. Alliierte durften
diesen Übergang nicht benutzen, sie mussten über den "Checkpoint
Charlie" ausreisen.
Heute dient der "tRÄNENpALAST" , der nun offiziell so heißt, als Veranstaltungsort für Konzerte.
Transitstrecken
Dieser Terminus wurde bei der BVG-West nach
Möglichkeit vermieden. In den Dienstvorschriften wurde von den
"Streckenabschnitten Ri - Ks und Mo - Vr" gesprochen. Die Abkürzungen
bezeichnen die Grenzbahnhöfe im BVG-Kürzel. Transitstrecken waren die
Abschnitte der U6 zwischen Kochstraße und Reinickendorfer Straße und U8
zwischen Moritzplatz und Voltastraße.
Triebwagen
Mit Fahrmotoren ausgestattetes Triebfahrzeug
mit mindestens einem Führerstand, in seltenen Fällen mit zwei Führerständen.
Vollmotorisiert: Ausgestattet mit vier Fahrmotoren
Halbmotorisiert: Ausgestattet mit nur zwei Fahrmotoren. (Nicht geeignet für den
Einsatz mit Beiwagen im Zugverband) Halbmotorisierte Wagen waren vornehmlich für
kurze Züge gedacht.
Der Triebwagen kann an der Zugspitze eingesetzt werden, aber auch in der
Zugmitte.
Zuggattungen: A-I, A-II, B-I, B-II, C-I, C-II, C-III, C-IV, E, E-III
Triebzug
Aus mehreren Wagen bestehender Zug, der keine Lok besitzt, sondern einen Antrieb
unter dem Wagenboden der Mehrzahl der Wagen. (wie bei einer U- oder S-Bahn)
Türantrieb
Fahrgasttüren besitzen heute einen Türantrieb.
Nach Ertönen des Warnsignals schließen sich die Türen selbsttätig. Ausgelöst
wird dies durch einen elektrischen Impuls vom Zugfahrer, wobei mittels eines
Ventils Druckluft (bezogen aus der Füllleitung der Bremsanlage) in die Türschließzylinder
strömt. Hierdurch werden die Türen verschlossen. Wenige Sekunden nach Abfahrt
des Zuges entweicht die Druckluft mittels eines weiteren Ventils wieder, die Türen
sind frei. Dies aber wurde ab geändert: siehe > Tür-Dauerverschluss.
Der Türantrieb wurde erstmals bei den C I-Wagen eingeführt, bei allen übrigen
C-Wagen bis nachgerüstet und serienmäßig bei allen Nachkriegszügen
versehen. Im Kleinprofil kam der Türantrieb erstmals bei den A3-Zügen zum
Einsatz, wurde bei den A2-Zügen aber nachgerüstet.
Die F-Züge (bis F-79.3) besitzen einen verbesserten Türantrieb: Die Türen
dieser Züge werden per Druckluft sogar geöffnet. Dies funktioniert folgendermaßen:
Während der Zug zum Stehen kommt, werden die Tür-Öffnungszylinder unter Druck
gesetzt, was deutlich unter dem Wagenfußboden hörbar ist. (Der Fahrer wählt
die Zugseite der freien Türen vor) Betätigt ein Fahrgast nun den Öffnungshebel,
schnellt die Tür per Druckluft auf. Hierbei wird die Druckluft erheblich
dekomprimiert und ist daher unbrauchbar. Aus diesem Grund wird die
dekomprimierte Druckluft über ein Ventil freigesetzt, wenn die Tür die geöffnete
Position erreicht hat, hörbar an dem bei diesen Zügen charakteristischen
Zischen, wenn die Tür offen ist.
Die älteren DL-, A3-, A3L- und G-Züge wurden seit mit einer
vergleichbaren Steuerung nachgerüstet.
Die Drehstrom-F-Züge (ab F 84) besitzen Schwenkschiebetüren, wobei die Türsteuerung
naturgemäß wesentlich komplizierter ist. Die neuesten Züge (H und HK) dagegen
besitzen einen elektrischen Türantrieb.
Tür-Dauerverschluss
Es war ein Volkssport oder auch eine Mutprobe, vom im Bahnhof einfahrenden Zug
so früh wie möglich abzuspringen. Dies war möglich, da die Fahrgasttüren
keinen Dauerverschluss besaßen. Anfang ordnete die Technische Aufsichtsbehörde
eine Umrüstung an, wonach Fahrgasttüren erst bei einer Geschwindigkeit von
unter 7 km/h frei geben dürfen. So lange sind die Türen unter Druck
geschlossen zu halten. Die BVG rüstete daraufhin alle vorhandenen Züge um. Sie
waren an den gelben Aufklebern erkennbar: "Türen bis zum Stillstand
verriegelt"
Die ab ausgelieferten F-Züge dagegen besitzen den Tür-Dauerverschluss bereits seit der Indienststellung. Jene Türen sind mechanisch verriegelt. Die Züge der seinerzeitigen BVG-Ost dagegen besaßen zu DDR-Zeiten nie einen Türdauerverschluss. Meines Wissens wurde er bei den E-III-Zügen (im Gegensatz zu den G-Zügen) nie nachgerüstet.
Tunneleule
Umgangssprachlicher Begriff für ein
U-Bahnwagen der Bauart B-I, der durch seine ovalen Stirnfenster auffällt.
Im Einsatz von bis .
Tunnelkatze
Umgangssprachlicher Begriff für einen
"Profilmesswagen" (siehe "Klingelfahrt")
Turmbahnhof
Ein U-Bahnhof, bestehend aus mindestens zwei
Bahnhofsbereichen, die turmartig über Kreuz angelegt sind. Klassisches Beispiel
ist der U-Bahnhof Leopoldplatz, wo die U9 die U6 in verschiedenen Ebenen kreuzt.
Ein Bahnhof im so genannten "Linienbetrieb". (siehe auch
"Richtungsbetrieb")
U
U-Bahn
Abkürzung für "Untergrundbahn"
Generell durch eine Kommune oder ein Privatunternehmen gebaute Schnellbahn, die
nicht zwangsläufig im Untergrund verlaufen muss, auf jeden Fall aber baulich
vom übrigen Verkehr völlig unabhängig ist. Weiteres Merkmal ist der regelmäßige
Taktverkehr.
U-Bahnen im engeren Sinne verkehren außer in Berlin in folgenden deutschen Städten:
Hamburg (seit ), München (seit ), Nürnberg (seit ) und Frankfurt
a.M. (seit ) soweit dort die U4 gemeint ist.
Alle weiteren in Deutschland so genannten "U-Bahnen" sind in Wahrheit
"Stadtbahnen".
Der Begriff "U-Bahn" wurde von der BVG für die "Hoch- und
Untergrundbahn" eingeführt und setzte sich in der Folgezeit für ähnliche
Stadtschnellbahnen im deutschsprachigen Raum durch. Der allgemeingültige
Begriff für U-Bahnen im internationalen Sprachgebrauch ist "Metro".
Die erste Bahn im Sinne einer U-Bahn verkehrte in London: Es war die unterirdische Fortsetzung einer britischen Eisenbahnlinie im Stadtgebiet von London. Schnell aber wurde diese mit Dampf betriebene Bahn von Fahrgästen genutzt, die nur innerhalb der britischen Hauptstadt vorwärts kommen wollten. Schon bald gab es Pläne zum Bau einer reinen kommunalen Untergrundbahn innerhalb der Stadt, die dann schließlich - ebenfalls in London - eröffnet wurde. Diese Bahn wies bereits ein weiteres Merkmal einer typischen U-Bahn auf: sie fuhr elektrisch. Nachdem die erste U-Bahn auf dem europäischen Kontinent eröffnet wurde, war der Siegeszug dieses effizienten Verkehrsmittels nicht mehr aufzuhalten: Eröffnung in Paris; in Berlin; in Madrid; in Barcelona und in Moskau.
U-Bahnkrieg
Die Stadt Wilmersdorf beabsichtigte seit etwa den Bau einer U-Bahn mit
Anschluss an das hochbahneigene Streckennetz verkehrsgünstig am
Wittenbergplatz. Hierzu aber musste diese Strecke durch Charlottenburger
Stadtgebiet geführt werden. An dieser Streckenanbindung aber hatte
Charlottenburg keinerlei Interesse; jene Stadt wollte sich die Option
freihalten, eine U-Bahnstrecke ab Wittenbergplatz unter dem Kurfürstendamm zu
errichten. Hierdurch wäre es aber unmöglich, zusätzlich noch eine
Wilmersdorfer Strecke am Wittenbergplatz auszufädeln. Die Hochbahngesellschaft
wiederum hatte größtes Interesse an der Wilmersdorfer Strecke. Letztlich waren
die Fronten zwischen den Städten, auch die Stadt Schöneberg mischte mit,
derart verhärtet, das Gesprächstermine platzten, weil keiner zu Zugeständnissen
bereit war. Erst durch ein Machtwort durch Minister > von Breitenbach konnten
die Zwistigkeiten geschlichtet werden und der U-Bahnkrieg Ende beigelegt
werden.
U-Bhf
Typische BVG-Abkürzung für U-Bahnhof. Neuerdings verzichtet die BVG sogar auf
den Punkt. Bahnamtlich wird ein Bahnhof mit "Bf." abgekürzt. Aber die
BVG ist halt nicht die Bahn...
U-deur
Auf dem U2-Bahnsteig des Bahnhofs Alexanderplatz hing Jahre lang ein kleiner
unscheinbarer Automat, den man als flüchtiger Betrachter leicht für einen
Kaugummiautomat halten konnte. Dort gab es was ganz besonderes für 2 DM zu
erstehen: Ein Duftflakon dessen Parfüm nach U-Bahn riechen sollte. Auf der
kleinen Schachtel steht: DIE ESSENZ U-DEUR ENTSPRICHT DEM GERUCH DER STATION
ALEXANDERPLATZ DER LINIE U2 VOM APRIL 00.
Wie das riecht? Lt. den Initiatoren Helgard Haug und Karl-Heinz Bork aus einer
Mischung aus Technik, Schienenfett, getränkten Schwellen, Reinigungsmitteln und
Backshop...
Überbrückung
"Anfahrsperre", Hilfsschalter
Der Druckwächter der Anfahrsperre verhindert ein Anfahren des Zuges bei nicht
vollständig gelöster Druckluftbremse (Druck in der Bremssteuerleitung unter
4,5 bar). Er unterbricht den Steuerstrom zu den Trennschützen, diese öffnen
und der Fahrmotorenstromkreis wird unterbrochen. Durch Einschalten des
Hilfsschalters "Überbrückung Anfahrsperre" wird dieser Druckwächter
überbrückt und der Fahrmotorenstromkreis kann wieder geschlossen werden.
Überflutungen
Diverse U-Bahntunnel in Berlin unterqueren Wasserläufe. In der 100-Jährigen
Geschichte hat es leider aber auch schon Überflutungen durch eindringendes
Wasser gegeben, nie jedoch in Friedenszeiten an fertigen Tunneln. Somit braucht
auch kein Fahrgast Angst haben, dass so etwas passieren könnte, zumal jede
Flussunterfahrung durch Sperrwehre gesichert werden kann.
wurde ein im Bau befindlicher und ein anschließender in betrieb
befindlicher Tunnel überflutet, als am Märkischen Museum der erste
Unterwasser-Tunnel unter der Spree gebaut wurde. Ursache war eine Unterspülung
des Rohbautunnels.
Der selbe Tunnel wurde im 2. Weltkrieg durch zwei Bombentreffer beschädigt,
weshalb es bis beständig zu einem Wassereinlauf kam.
Im Mai wurde von zurückziehenden deutschen Truppen der S-Bahntunnel unter
dem Landwehrkanal gesprengt. In der Folge lief der komplette Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel
voll und da am Bahnhof Friedrichstraße ein Verbindungsgang zur U-Bahn
existiert, stand auch rund ein Drittel des U-Bahnnetzes für Wochen vollständig
unter Wasser.
Überhöhung
Ein Gleis ist in der Kurve stets "überhöht"
was bedeutet, dass die kurvenäußere Schiene eines Gleises stets höher liegt
als die kurveninnere Schiene, hierdurch der Zug in der Kurve geneigt wird. Die
größte Überhöhung beträgt 150 mm.
Überwerfungsbauwerk
Tunnelkonstruktion bei dem sich zwei
Strecken verzweigen und dabei Gleise in verschiedenen Höhenlagen
"niveaufrei" gekreuzt werden.
Umformer
Ein Umformer besteht aus einem mit 750 Volt angetriebenen Elektromotor und einem
mechanisch gekoppelten 110 Volt Spannung produzierenden Generator. Mit einem
Umformer dieser Art wird aus dem Fahrstrom der für die Nebenverbraucher eines
U-Bahnzuges benötigte Steuerstrom gewonnen. Dieser wird für alle elektrischen
Verbraucher außer den Fahrmotoren benötigt. Die ersten Umformer wurden bei
U-Bahnwagen ab dem Baujahr: 1906 verwendet.
Umlauf-Betrieb
Normale Betriebsform auf U-Bahnstrecken,
wobei die Züge im Rechtsverkehr umlaufen. (im ggs. zum
"Pendelverkehr")
Unfälle
Schwere Unfälle hielten sich in der Geschichte der Berliner U-Bahn zum Glück
in engen Grenzen. Spektakulär war das Hochbahnunglück im September , wobei
zwei Züge auf dem Gleisdreieck zusammenstießen und ein Wagen vom Viadukt stürzte.
In diesem Fall wurden die roten Signale übersehen. Ein weiterer schwerer Unfall
ereignete sich im Juni , als zwischen den Bahnhöfen Zoo und Hansaplatz ein
Zug nicht rechtzeitig bremsen konnte und einem anderen auffuhr. Hier wurde an
der Signalanlage manipuliert. In beiden Fällen war menschliches Versagen die
Ursache.
Untergrundbahn
Im Untergrund verkehrende Stadtschnellbahn,
in aller Regel eine "U-Bahn".
Unterpflasterbahn
Untergrundbahn, die in einer geringen
Tiefenlage unter dem Straßenpflaster verläuft. Klassisches Beispiel hierfür
ist die Schöneberger U-Bahn.
Unterwerk
Betriebsraum, in dem der vom Kraftwerk
gelieferte hochgespannte Strom (in aller Regel 10.000 Volt) auf für die U-Bahn gebrauchsfähige Spannung
(750 Volt) umgestellt wird. Jedes Unterwerk versorgt zumeist mindestens zwei
sogenannte "Bahnspeisebezirke". Unterwerke sind personell nicht
besetzt und werden von der "Fernsteuerwarte" ferngesteuert. Die
Fernsteuerwarte befindet sich an der Turmstraße.
Lage der Unterwerke: Siehe Plan > Stromspeisebezirke.
V
van der Cypen und Charlier
Dieses in Köln ansässige Unternehmen baute in den Jahren und für
die Hochbahngesellschaft einige U-Bahnwagen
VDV
Verband deutscher Verkehrsunternehmen
Dem VDV sind derzeit rund 500 Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs
und des Güterverkehrs (mit Schwerpunkt Eisenbahngüterverkehr) angeschlossen.
Die BVG ist Mitglied im VDV.
Verkehrsmeister
Älterer Dienstgrad für einen Mitarbeiter der BVG, der für den ordnungsgemäßen
Betriebsablauf in seinem Bezirk verantwortlich ist. Dieser Tätigkeitsbereich
wird heute vom "Gruppenleiter" betreut.
VnK-Strecke (Verbindung
nach
Kaulsdorf)
Die VnK-Strecke war früher Bestandteil der
Ostbahn und diente in erster Linie dem Fern- und Güterverkehr unter Umgehung
von Lichtenberg Richtung Strausberg/Küstrin (Königsberg). Nach dem WK II fiel
der Fernverkehr weg, so dass nur noch gelegentliche Güterfahrten stattfanden.
Später wurden Teile dieser Strecke stillgelegt. Ab wurde auf einem Teil
dieser Strecke die U-Bahn Richtung Hönow gebaut. Nur der Streckenteil
Rummelsburg - Berliner Außenring (BAR) wird noch von gelegentlichen Güterzügen
genutzt. Der Rest bis Wuhletal ist heute Bestandteil der Linie U5.
VUM
Verkehr - U-Bahn - Meldestelle
Leit- und Koordinierungsstelle für den U-Bahnbetrieb ist verantwortlich für
den ordnungsgemäßen Betriebsablauf im gesamten Netz. Heute heißt diese
Einrichtung "LDU"
W
Wabco-Gerät
Ähnlich des Antiblockiersystems bei einem
Auto überwacht das Wabco-Gerät, dass die Räder eines U-Bahnzuges nicht
gleiten oder beim Bremsen blockieren.
Waisentunnel
D-E-Tunnel, Verbindungstunnel zwischen den
Linien U8 und U5 unter der Littenstraße. Bezeichnung "Waisentunnel"
entstand vermutlich aufgrund der Nähe zur Waisenstraße
Wand-Sohle-Bauweise
Diese Bauweise erfordert kein Absenken des
Grundwassers während des Baus. In ausgehobenen Schlitzen werden die Betonwände
gegossen und erst anschließend im Schutz zwischen den Wänden die Baugrube
ausgehoben.
Wanne
Kiosk-artiger gläserner Bau in den U-Bahnzugängen, aus denen heraus
Fahrscheine verkauft und auch entwertet wurden. Aufgrund der Einführung
automatischer Entwerter und Fahrscheinautomaten wurden die "Wannen"
überflüssig. Sie wurden zwischenzeitlich weitgehend entfernt. Nur an wichtigen
U-Bahnhöfen kann man noch Fahrscheine beim Personal erwerben.
Wechselstrom
Elektrischer Strom, dessen Stärke und Richtung sich periodisch ändert.
Wechselstrom eignet sich hervorragend zur Übertragung über längere Distanzen.
Die BVG bekommt für die U-Bahn den Strom in Form von auf 10.000 Volt gespannten
Wechselstrom, der in den BVG-eigenen Unterwerken auf 750 V > Gleichstrom
umgewandelt wird.
Bei der Fernbahn dagegen wird mit Wechselstrom gearbeitet.
Wehrkammeranlagen
Die Wehrkammern mit ihren Absperrschützen dienen zur Sicherung der U-Bahntunnel
gegen Wassereinbruch bei den Fluss- und Kanalunterfahrungen. Die Absperrschütze
(absenkbare Tore) befinden sich stets jeweils kurz vor und hinter den
Unterfahrungen. Sie werden teils elektrisch und teils per Hand bedient. In
regelmäßigen Abständen werden diese Wehre auf ihre Funktionstüchtigkeit hin
geprüft.
Werkstätten
Zur Wartung gibt es mehrere verschiedene Werkstätten:
> Hauptwerkstatt: HW U
Zuständig für die Hauptuntersuchungen am gesamten Wagenpark
> Betriebswerkstätten: BW U
Zuständig für kleinere Reparaturen am Wagenpark (es gibt 3 BWs)
> Bahnmeistereien:
Zuständig für die Wartung der Gleisanlagen
Werkstatt Gleisdreieck:
Zuständig für die Unterhaltung der Bahnhofsanlagen.
Westberlin
Im offiziellen Bild der DDR übliche herabwürdigende Bezeichnung für den
Westteil der Stadt, dessen die DDR nicht müde wurde zu behaupten, dass
"Westberlin eine besondere politische Einheit ist, die nicht von der BRD
regiert werden darf." (In Stadtplänen las man hin und wieder auch
"Westberlin, Politisches Besatzungsgebiet der USA, Großbrittanien und
Frankreich")
Nach DDR-Verständnis war Westberlin nie Bestandteil eines anderen Staates, noch
nicht mal ein selbst ein Staat, sondern stets ein "Besonderes politisches
Gebilde". Das ging soweit, dass in einem ganz gewöhnlichen DDR-Reisepass
folgender Satz stand: "Gültig in allen Staaten und in Westberlin."
Im westdeutschen Sprachgebrauch wurde aus
vorgenannten Gründen der Begriff "Westberlin" nie verwendet, hier
sprach man schlicht von "Berlin" oder "Berlin (West)".
"West-Berlin" ging so gerade noch in Ordnung.
Am Rande sei erwähnt, dass dies mit dem Begriffskürzel "BRD" genauso
war, an Hamburger Schulen zum Beispiel durfte "BRD" nie an der Tafel
stehen! Kann mich noch gut dran erinnern, wie ich völlig wertfrei
"BRD" an die Tafel schrieb und daraufhin eine Rüge von meinem
Politiklehrer erhielt!
Westend-Strecke
Streckenabschnitt der U2 zwischen Deutscher
Oper und Theodor-Heuss-Platz. Fertiggestellt im Jahre .
Westliche Stammstrecke
Streckenabschnitt der U2 zwischen
Gleisdreieck und Ernst-Reuter-Platz. Fertiggestellt im März
Wiederverwendete Bauwerke
Man soll es gar nicht glauben, auch so etwas gibt's in Berlin: Einige
Bahnhofsbestandteile sind schlicht recycelt: Im U2-Bahnhof Fehrbelliner Platz
befinden sich Treppengeländer, die sich bis auf der Kaiserdammbrücke als
Geländer befanden. Im U-Bahnhof Innsbrucker Platz befinden sich Stützpfeiler
vom abgerissenen U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz. Doch damit nicht genug:
Der U-Bahneingang des Bahnhofs Neu-Westend stammt von der Schöneberger U-Bahn:
Er befand sich bis auf dem Nollendorfplatz und diente als Zugang zum
geschlossenen > Motzstraßenbahnhof.
Wilmersdorfer U-Bahn
Streckenabschnitt der U1 zwischen
Wittenbergplatz und Breitenbachplatz, im engeren Sinne zwischen
Hohenzollernplatz und Breitenbachplatz. Diese U-Bahnstrecke wurde von der damals
selbständigen Stadt Wilmersdorf in den Jahren bis erstellt. Charakteristisch
für diese Strecke ist die im verwendeten Material gehobene Ausstattung der
Bahnhöfe mit damals unüblichen Massivstützpfeilern und Kassettendecke, sowie
aufwendiger Gestaltung der Zugangssituationen zu den Bahnhöfen. Ursache hierfür
ist das Repräsentationsdenken Wilmersdorfs gegenüber den nicht minder vermögenden
anderen Vorstädten Schöneberg und Charlottenburg und nicht zuletzt gegenüber
der Reichshauptstadt Berlin.
Was zeichnete eine reiche Berliner Vorstadt um aus? Ein protziges Rathaus und eine eigene U-Bahnstrecke!
Witte, Ursulina (siehe Schüler,
Ralf)
siehe > Schüler, Ralf
Wüstenbahn
Als die "Westendstrecke" unter dem
Kaiserdamm im Jahre eröffnet wurde, war dieses Areal noch weitgehend
unbebaut. Erst im Laufe der Jahre entstanden die Wohngebiete im heutigen Sinne.
Damals fuhr die Bahn daher in die unbewohnte "Wüste".
Z
Zapper
BVG-Umgangssprachlich für den "Za",
den Zugabfertiger.
ZSA-Betrieb
Zugfahrer-Selbstabfertigungs-Betrieb
In dieser erstmals bei der BVG auf der U4 eingeführten Betriebsform
fertigt der Zugfahrer seinen Zug über Spiegel oder Kameras selbst ab. Der
stationäre Zugabfertiger wurde dadurch entbehrlich. Im Jahre wurde als
letzte Linie die U7 auf ZSA-Betrieb umgestellt. Schon seit gibt es auf schwächer
frequentierten Bahnhöfen entsprechende Versuche, wo der Zugbegleiter die
Abfertigung im Bahnhof übernahm und somit den Zugabfertiger ablöste.
Z.e.P.
Abkürzung für "Zeitweilig eingleisiger Pendelverkehr". Übliche
Betriebsform bei Bauarbeiten in den U-Bahnanlagen.
Züge
Hierzu die > DVU:
Züge sind Fahrzeugverbände in beliebiger Anzahl, deren Spitze und Schluss nach
dem > Signalbuch gekennzeichnet sind. (Wie
gekennzeichnet, erfahren Sie hier)
Unterscheidung der Züge nach ihrem Einsatz:
- Fahrgastzug: Der Fahrgastzug verkehrt täglich
nach einem festgelegten Fahrplan
- Leerzug: Ein Leerzug verkehrt ohne Fahrgäste
nach einem festgelegten Fahrplan oder außerplanmäßig auf Anweisung
- Schmierzug: Der Fahrschienenschmierzug kann als
Leer- oder als Fahrgastzug zur Schmierung der Schienenflanken eingesetzt werden.
Als Leerzug wird der Einsatz des Schmierzuges nach einen Fahrplan geregelt. Zusätzlich
gibt es im Kleinprofil einen Stromschienenschmierzug, der als Leerzug nur auf
Anordnung eingesetzt wird.
- Bürstenzug: Der Bürstenzug wird nach Anweisung
als Leerzug im Kleinprofil zur Laubbeseitigung eingesetzt.
- Hilfsgerätezug: Der H. ist mit technischen
Hilfsmaterial ausgerüstet und dient zur Bergung havarierter oder entgleister Züge.
- Arbeitszug: Der A. verkehrt zur Beförderung von
Geräten und Materialien oder zur Unterhaltung der Bahnanlagen.
- Ausbildungszug: Der A. dient zur
Personalausbildung (Fahrschule) und wird auf Anweisung eingesetzt.
Zweiachs-Längsantrieb
Ein im Drehgestell mit der Fahrtrichtung längs liegender Fahrmotor treibt beide
Achsen eines Drehgestells mittels einer durchlaufenden Hohlwelle an. Eine
Variante des Zweiachs-Längsantriebs ist die Verwendung von zwei unabhängig
hintereinander angeordneten Motoren. Diese Bauform findet man heute bei den
Drehstrom-Zügen.
Die Bauform des Z.-L. ist seit bei den Berliner U-Bahnzügen üblich. (im Ggs. zum
>"Tatzlagerantrieb")
200-Km-Plan
Rahmenplan zum Ausbau des Berliner
U-Bahnnetzes. Wurde erstmals festgelegt und in den Jahren bis
aktualisiert. Er sah den Ausbau des Streckennetzes auf eine Gesamtlänge von 200
Kilometern vor.
Anhang
Abkürzungen
für den fahrdienstlichen
Schriftverkehr
Anmerkung: Die Abkürzungen für die U-Bahnhöfe finden Sie hier: Bahnhofsnamen
ASU
Arbeitsschutzuntersuchung
Astgl
Aufstellgleis
Az
Arbeitszug
Azf
Arbeitszugführer
baw
bis auf weiteres
Bb
Bahnhofsbetreuer
Bbg
Betriebsbeginn
Bedkgl
Bedarfskehrgleis
Bhf
Bahnhof
BLU
Betriebsleitstelle U-Bahn
Bschl
Betriebsschluss
Bstg
Bahnsteig
Bstggl
Bahnsteiggleis
Bwg
Beiwagen
Bw
Betriebswerkstatt
Dano
Dienstanordnung
Dr
Dienstraum
Dst
Dienst
Du
Dienstunterweisung
DUV
Dienstanweisung Unfallverhütung
DVU
Dienstvorschriften U-Bahn
Fh
Fahrhilfe
fmdl
fernmündlich
Fl
Fahrlehrer
Fm
Fahrmeister
Fpl
Fahrplan
FV
Fahrdienstvorschrift
Fzg
Fahrzeug
Gl
Gleis
Grp
Großprofil
Gs
Gleissperre
Gü
Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung
Hfg
Handfunkgerät
HZG
Hilfsgerätezug
K
Kuppelstelle
Klp
Kleinprofil
km/h
Kilometer pro Stunde
KS
Kuppelschalter
La
Langsamfahrabschnitt
LStw
Linienstellwerk
Lz
Leerzug
LZB
Linienzugbeeinflussung
MOd
Mitarbeiter im Ordungsdienst
mdl
mündlich
Min
Minute
NLU
Netzleitstelle U-Bahn
OdM
Ordnungsdienst Meldestelle
Ovm
Oberverkehrsmeister
Pz L
Personal-Leerzug
Res
Reserve
Rstw
Regionalstellwerk
Sakra
Sicherungsausfsichtskraft
SBU
Signalbuch U-Bahn
Sdzg
Sonderzug
SEV
Schienenersatzverkehr
Sig
Signal
Sipo
Sicherungsposten
Sl
Schichtleiter
Stm
Stellwerksmeister
Stw
Stellwerk
Twg
Triebwagen
U
Umformerwerk
Ügl
Überführungsgleis
Uml
Umlauf
Vgl
Verbindungsgleis
Vm
Verkehrsmeister
Wg
Wagen
Wügl
Wagenübergabegleis
Wk
Wehrkammer
Za
Zugabfertiger
z.b.V.
zur besonderen Verwendung
ZeP
Zeitweise eingleisiger Pendelbetrieb
Zf
Zugfahrer
Zgr
Zuggruppe
Zpf
Zugprüfer
ZSA
Zugfahrerselbstabfertigung